Der Rote Faden
Eingestiegen sind wir in den Bereich WELTZUGÄNGE über das Thema „Spiritualität“, das dann in zwei Teilaspekten (Religion und Esoterik) noch genauer betrachtet wird. Gemeinsam ist diesen Zugängen die Tendenz, emotionale Verankerung in einer eher jenseitigen, oft auch mystisch-irrationalen Ideenwelt zu finden .
Nun ist aber nicht jede Form der Sinnsuche in dieser Form transzendent oder alltagsfern. Menschen gelingt es , ihren persönlichen Lebenssinn in ganz unterschiedlichen Bestrebungen bzw. Aktivitäten zu finden. Einige dieser „weltlichen“ Quellen für Sinn und Bedeutung werden in diesem Kapitel vorgestellt.
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Was verleiht unserem Leben Bedeutung?
Vorlesen lassen
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Es ist ganz sicher eine sehr grundsätzliche und in allen bekannten Kulturen verankerte menschliche Tendenz, neben der Sicherung von Grundbedürfnissen und einem Streben nach Erkenntnis bzw. Kontrolle auch Ideen und Hoffnungen zu entwickeln, die über den Horizont des Alltagslebens hinausreichen.
Das wachsende Großhirn (der Neo-Cortex) schuf nicht nur kognitive Ressourcen für die immer intelligentere Lösung der Überlebensprobleme und für ein zunehmend komplexeres soziales Miteinander, sondern eröffnete auch Raum für abstraktere Fragen und Überlegungen. Es entstanden auf der einen Seite Ideen, Geschichten und Religionen, die sich mit dem Anfang der Welt, dem Tod, dem Ziel des Daseins, dem Schicksal bzw. der Bestimmung des einzelnen Lebens befasst haben.
Auf der Seite des aktiven Tuns entwickelten sich verschiedenste Riten, in denen mit Hilfe von Tanz, Gesang, Opfergaben, Gebeten, Rauschmitteln, Isolation, Schmerz, usw. Zugänge zu besonderen Erlebnisbereichen gesucht und gefunden wurden. Dabei ging es vermutlich von Anfang an um Gemeinschaftserleben, um Gefühle von Zugehörigkeit und Geborgenheit, um eine emotionale Verbindung zur belebten und unbelebten Natur, um die Bewältigung existenzieller Ängste und die Suche nach alternativen Bewusstseinszuständen.

In der Sprache eines vielbeachteten Buches des Soziologen Hartmut ROSA könnte man all diese Tendenzen und Bemühungen als Suche nach „Resonanz-Beziehungen“ betrachten: Menschen hatten und haben das Bedürfnis, sich in einer Welt zu befinden, in der sie eine Art Antwort oder Echo auf ihr Sein und ihr Handeln erhalten. Es geht um eine Ebene, die über das Welterkennen und die praktische bzw. funktionale Nutzung und Beherrschung der Umwelt hinausgeht.
In unser modernen Welt gibt es für solche Erfahrungen von Spiritualität und Transzendenz neben einer Naturverbundenheit, den Rauschmitteln und traditionellen religiösen Quellen etliche andere (z.B. esoterische) Angebote (s. dazu das Kap. „Spiritualität„).
Hier geht es aber um einen weiter gefassten Ansatz, in dem möglichst viele Aspekte der Suche nach Sinnhaftigkeit und Bedeutung Platz haben. Es geht um alle Ziele, Strebungen und Aktivitäten, die auf eine innere Erfüllung durch Ausweitung der Perspektiven und Erfahrungen gerichtet sind.
Gibt es einen objektiven Lebenssinn?
Wie absurd die Vorstellung von einem vorgegebenen, objektiven Sinn ist, wird vielleicht durch folgendes Gedankenexperiment deutlich:
Wären wir die einzigen intelligenten Lebewesen im gesamten Kosmos, dann wäre die Frage nach dem (oder irgendeinem) Sinn nur dadurch in die Welt gekommen ist, dass an einem bestimmten Moment der Evolutionsgeschichte auf diesem Planeten infolge bestimmter Mutationen eine Weichenstellung zu einem größer werdenden Gehirn des Menschen eröffnet wurde. Nur in einem solchen Gehirn konnten sich höhere kognitive und selbstreflexive Funktionen ausbilden, die auch abstrakte Konzepte und existentielle Fragestellungen hervorbringen können.
Wäre dieser biologische Abzweig gescheitert oder wäre der Meteorit, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, nur noch ein wenig größer gewesen oder wäre in einem andern Winkel aufgeschlagen, dann hätte es in dem gesamten Kosmos niemals die Frage nach dem Sinn bzw. Kategorien wie „Bedeutung“, „Ziel“, „Bestimmung“, usw. gegeben. Solche Ideen existieren in einem Kosmos ohne Großhirne schlichtweg nicht – genauso wenig wie so wunderbare Ideen wie „Schönheit“, „Liebe“ oder „Würde“.
Das klingt vielleicht alles hart und sehr nüchtern – aber diese Sichtweise hat eine bestechende Logik.
Es kann also keinen objektiven Sinn geben, der außerhalb unserer evolutionär bedingten emotionalen Bedürfnisse und kognitiven Ressourcen liegen könnte. Jede andere Auffassung – z.B. von einem allgemein beseelten bzw. bewussten Kosmos oder einem sinnhaften göttlichen Schöpfungsakt – liegt außerhalb des hier vertretenen rationalen Weltverständnissen (in dem wir ja prinzipiell unbeweisbare Zusatzannahmen vermeiden wollen).
Die 7 Sinnquellen

Schauen wir uns die 7 potentiellen sinngebenden Bereiche aus unserer Selbstbefragung ein wenig genauer an. Natürlich ist die Aufzählung nicht vollzählig.
Selbstentfaltung
Wir kommen mit einer sehr spezifischen Kombination von Potentialen auf die Welt, die bis zum Zeitpunkt unserer Geburt durch unsere Gene und unsere – schon sehr komplexe und störanfällige – vorgeburtliche Entwicklung bestimmt wurde. Was mit diesen Voraussetzungen dann weiter im Wechselspiel mit unserer Umwelt passiert, wurde in den Kapiteln Ichwerdung und Lebenslenkung betrachtet. In verschiedenen Menschenbildern sind Vorstellungen darüber zusammengefasst, wie selbstbestimmt wir als (vermeintlich) autonome Individuen auf unsere Persönlichkeitsentfaltung Einfluss nehmen können.
Da wir uns auf jeden Fall subjektiv als weitgehend frei entscheidungsfähig erleben, gehört für viele Menschen die Verwirklichung der angelegten Potentiale (z.B. Begabungen) zu den zentralen Lebenszielen. Eine früh spürbare Musikalität oder eine zeichnerische Kreativität zu entwickeln, angelegte athletische Ressourcen zu nutzen oder spezielle kognitive Fähigkeiten gezielt auszubauen, beinhaltet für viele mehr als einen naheliegenden pragmatischen Nutzen: Sie spüren darin so etwas wie eine sinngebende Bestimmung, eine Zielsetzung, die ihr irdisches Dasein abrundet und veredelt.
Was zunächst so sinnvoll und positiv klingt, kann natürlich auch Schattenseiten beinhalten: So kann das Bedürfnis zur Selbstentfaltung in einen zwanghaften Selbst-Optimierungswahn abdriften; so kann das Selbstverwirklichungs-Bestreben zu einer egomanischen Selbstbezogenheit führen, die asozial und einsam machen kann. Wir alle kennen Beispiele von besonders exzentrischen Künstlern, bei denen sich das ungebremste Ausagieren eigener Kreativität nur noch schwer mit einer alltags- bzw. gemeinschaftsbezogenen Lebensführung vereinbaren ließen. Vermutlich hat das deren Überzeugung, für ihr Leben einen Sinn gefunden zu haben, nicht beeinträchtigt…
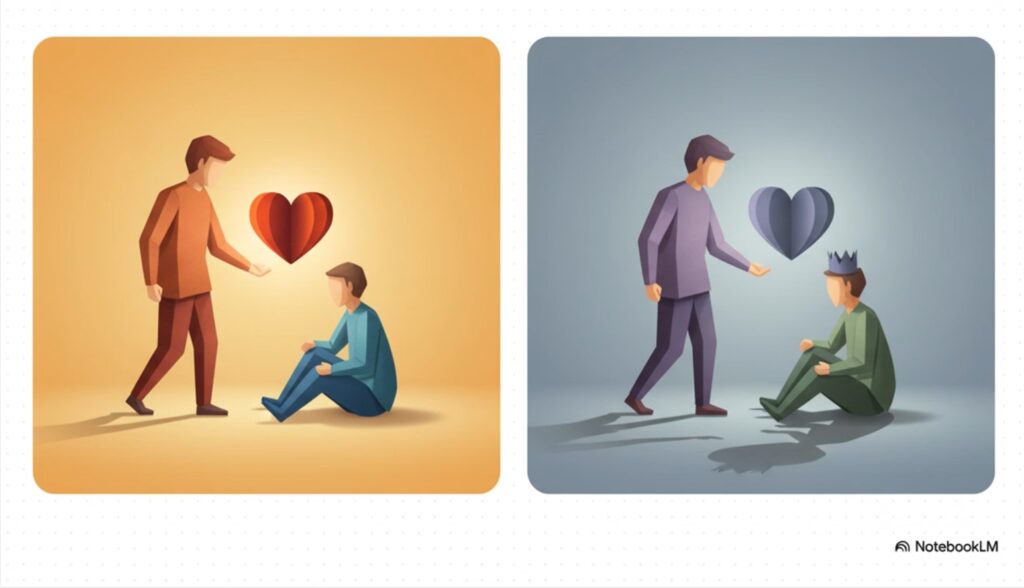
Erkenntnis
Das Bedürfnis, möglichst viel Wissen und Erkenntnis über die Welt als Ganzes (oder in Ausschnitten) zu erlangen, kann als ein Teilbereich der gerade diskutierten Selbstentfaltung angesehen werden. Ziel ist es dabei nicht das optimale Nutzen eigener Gehirn-Kapazitäten; stattdessen geht es um die Befriedigung, die mit einem fortschreitenden Weltverständnis verbunden ist.
Wo religiöse Menschen vielleicht vor der Komplexität und Schönheit der Schöpfung in demütiger Ehrfurcht verharren, sehen es neugierige und wissbegierige Artgenossen als anregend und erfüllend an, den Gesetzmäßigkeiten der unbelebten und belebten Natur so weit wie eben möglich auf die Spur zu kommen. Dieser Prozess muss keineswegs emotionslos bzw. rein technisch-funktional sein: Das Eindringen in immer kleinere bzw. größere Dimensionen kann mit Staunen und Ehrfurcht verbunden sein und vielleicht sogar transzendente Aspekte beinhalten.
Die Befriedigung über das Erkennen bisher unerkannter Zusammenhänge oder über eine neue Möglichkeit, Facetten der Natur in elegante mathematische Gleichungen zu fassen, kann weit über den wissenschaftlichen, technischen oder materiellen Nutzwert hinausgehen: Der Erkenntnisfortschritt trägt sein Ziel in sich selbst!
Altruismus
Dass der Mensch von Natur aus nicht nur ein soziales, sondern auch ein moralisches Lebewesen ist, wird an anderer Stelle ausführlich diskutiert.
Die Tatsache, dass zahllose Menschen einen Großteil ihres Lebens dem Dienst für ihre Mitmenschen widmen, kann in den meisten Kulturen und in verschiedensten historischen Epochen beobachtet werden.
Ob in religiösen Traditionen, philosophischen Abhandlungen oder literarischen Werken – der Gedanke, dass wahre Erfüllung im selbstlosen Handeln für andere liegt, bleibt eine der faszinierendsten Facetten menschlichen Lebens. Er bietet nicht nur einen Ausweg aus der oft individualistisch geprägten Selbstbezogenheit, sondern zeigt, wie tief unsere Existenz mit der Gemeinschaft und dem Wohlergehen anderer verknüpft ist.
Kritische – manchmal auch eher zynische – Geister machen gerne darauf aufmerksam, dass der vermeintlich so selbstlose Altruismus ja auch einen persönlichen Gewinn beinhalte, z.B. für ein positives Selbstbild und für soziale Anerkennung. So ließe sich dann altruistisches Verhalten zu einer Sonderform des Egoismus umdeuten (modern: „reframen“). Allerdings fallen diese – oft ausgesprochen selbstbezogenen – Altruismus-Skeptiker bei genauerer Betrachtung gerade in diesem Bereich nicht durch besonderes Engagement auf: Es scheint wohl doch einen gewissen Unterschied zu machen, wie man seinen Egoismus auslebt…
Beziehungen
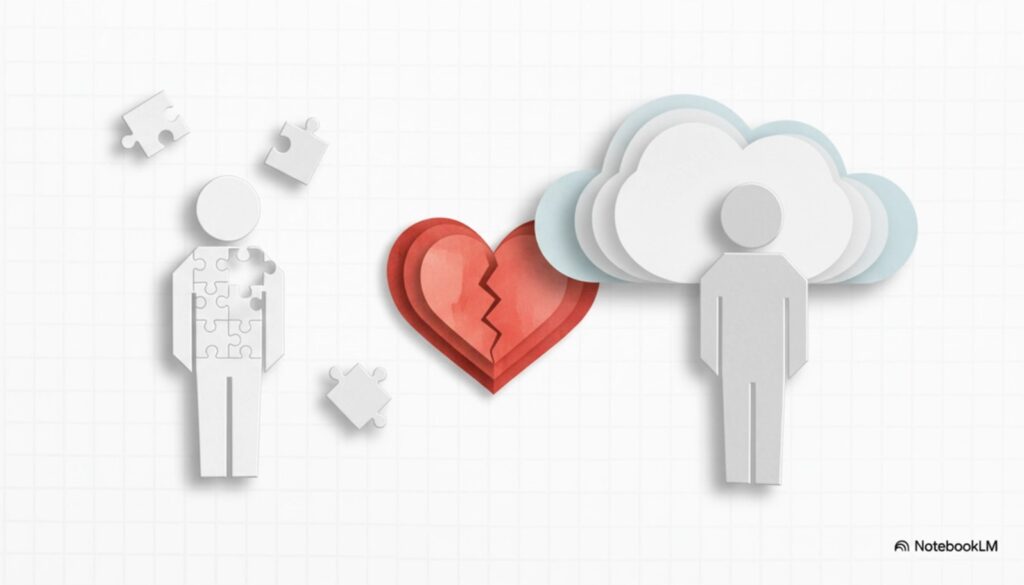
Über eine allgemeine altruistische Einstellung bzw. Lebensweise hinaus sind natürlich auch die intensiven persönlichen Beziehungen für die meisten Menschen eine geradezu natürlich und selbstverständliche Sinnquelle. In Beziehung zu sein ist für die Gattung Mensch von frühester Kindheit an so fundamental und existentiell wie bei keinem anderen Lebewesen. Wir sind schlichtweg noch nicht biologisch fertig, wenn wir geboren werden; unsere Aufzucht verlangt von Eltern bzw. der Gemeinschaft einen beispiellosen Aufwand.
Enge Beziehungen begleiteten die meisten jemals lebenden Menschen ganz selbstverständlich durch ihren gesamten Lebenslauf. Der in modernen westlichen Gesellschaften gefeierte Individualismus – mit seiner Vereinzelung und Vereinsamung – ist auf diesem Hintergrund eine sehr neue und bedenkliche Entwicklung.
Für die meisten Menschen schafft wohl auch heute noch die Einbettung in familiäre, freundschaftliche, kollegiale und partnerschaftliche Beziehungen so etwas wie ein Sinn-Fundament. In sehr intensiven Freundschafts- und Liebesbeziehungen kann dieser Sinnaspekt auch eine existentielle Tiefe bekommen, die vielleicht andere nur in traditionellen spirituellen Bereichen finden oder vermuten (vgl. den Abschnitt über „Liebe“ im Kapitel „Spiritualität“).
Spuren hinterlassen
Dass sich Menschen als Teil einer Generationsfolge wahrnehmen und erleben, lässt sich weit bis in unsere Frühgeschichte zurückverfolgen. Die Verehrung von Ahnen und die Versuche, mit Verstorbenen bzw. ihren Geistern Kontakt aufzunehmen, hat wohl schon vor Zehntausenden Jahren die menschliche Kulturentwicklung mitgeprägt.
Doch auch in die andere Richtung hat das Prinzip der „Intergenerationalität“ die Geschichte der Menschheit bestimmt: Die Weitergabe von Wissen, Fertigkeiten, Mythen und Besitztümer an die Nachfolge-Generationen war sowohl in Familien und Kleingruppen, als auch in größeren Gemeinschaften ein anerkanntes Ziel. Die Frage, wie genau Landbesitz, Privilegien und angehäufter Reichtum weitervererbt werden soll, gehört(e) oft zu den wichtigsten gesellschaftlichen Regeln und hat(te) weitreichende Auswirkungen auf ganze Geschichtsepochen.
Während die Besitzer von Familienunternehmen und Immobilien weiterhin in Generationsfolgen denken, spielt der wirtschaftliche Aspekt für die Durchschnittsverdiener meist keine besondere Rolle.
Im Zeitalter des Individualismus und der Selbstverwirklichung hat sich bei vielen modernen Menschen eine Verlagerung ihrer Perspektive auf die eigene Lebensspanne ergeben: Wohlstands- und konsumverwöhnte Eltern leben heute nicht mehr so selbstverständlich wie früher für die Zukunft ihrer Kinder; sie wollen (erstmal) selbst das Leben auskosten – z.B. mit regelmäßigen Kreuzfahrten auch im 9. Lebensjahrzehnt.
Unabhängig von solchen gesellschaftlichen Trends gibt es aber bei vielen Menschen ein Bedürfnis, auf irgendeinem Gebiet Spuren zu hinterlassen – wenn schon nicht für die Ewigkeit, so doch für ein bis zwei Generationen. Angesichts des Bewusstseins der eigenen Endlichkeit und eines zunehmenden Zweifel an einem „Leben nach dem Tod“ beinhaltet das Hinterlassen von Gebäuden, Kunstwerken, Texten, Stiftungen oder Sammlungen auch einen Sinnaspekt. Doch die Hoffnung auf bleibende Spuren ist keineswegs auf das Materielle beschränkt: Das Wirken der eigenen Person als Elternteil, Pädagoge, Priester, Therapeut, Partner, Geschwister, Freund, Nachbar, Trainer, Kollege, Mentor, usw. hinterlässt ohne Zweifel Spuren in Psyche und Persönlichkeit der Bezugspersonen.
In gewisser Weise verändert jede/r von uns die Welt ein ganz klein bisschen (optimaler Weise zum Guten) – und das kann für viele Trost und Sinn stiften. Das – so offensichtlich begrenzte – eigene Leben bekommt so einen Hauch von Unvergänglichkeit.
Jenseitigkeit
Wir wollen die ganz großen Sinnsysteme, die von ihren Ansprüchen über die Grenzen der weltlichen Alltäglichkeit hinausgehen, natürlich nicht unter den Teppich kehren.
Im Gegenteil: Den auf Spiritualität und Transzendenz ausgerichteten Sinnangeboten (z.B. Religionen, Esoterik) wurde ein gesondertes Kapitel zugebilligt.
Sie sollten hier aber zumindest genannt und in unserem kleinen Test auch berücksichtigt werden.
Hedonismus
Kann oder darf man eine hedonistische Lebenseinstellung wirklich im Kontext von Sinnquellen betrachten? Ist nicht die Beschränkung der Lebensziele auf eine möglichst umfangreiche und schnelle Bedürfnisbefriedigung das Gegenteil, also die explizite Abwendung von jeglicher Sinnsuche?
Diese Bewertung wäre wohl voreilig und zu einseitig: Wie wollte man seriös begründen, dass die Suche nach Lustgewinn und Genuss nichts mit einer Sinngebung für das menschliche Dasein zu tun hat?
Eine hedonistische Lebenseinstellung muss nicht zwangsläufig oberflächlich oder gar egozentrisch sein. Vielmehr können das bewusste Erleben von Freude, das Streben nach Authentizität und persönlichem Glück als wichtige Bausteine für ein erfülltes und sinnvolles Leben betrachtet werden. Sowohl klassische philosophische Modelle wie der Epikureismus als auch moderne Ansätze der positiven Psychologie liefern bedenkenswerte Argumente dafür, dass das Streben nach Lust und Wohlbefinden ein legitimer Weg zur Sinnsuche sein kann.
Ob purer Hedonismus jedoch ohne Anleihen bei anderen Sinnquellen wirklich zum Vorbild für ein gelingendes und erfülltes Leben taugen kann, darf zumindest stark bezweifelt werden.
Resümee
Wir wollen in diesem Kapitel die Überlegungen des ersten Buchteils nicht völlig aus den Augen verlieren und uns folgende Fragen stellen:
Ist es wirklich völlig beliebig, in welchen Ideenwelten und mit welchen Praktiken wir uns auf die Suche nach Lebenssinn machen?
Hat es einen Preis, wenn wir unsere Weltzugänge in Bereichen suchen und pflegen, die in einem deutlichen Widerspruch zu unseren rationalen Erkenntnisquellen stehen?

Es gibt – so hat dieses Kapitel gezeigt – durchaus eine große Auswahl an Sinnquellen, die sich mit einem rationalen Weltbild vereinbaren lassen. Auch wenn daraus natürlich nicht eine „Höherwertigkeit“ solcher Optionen ableiten lässt, so bieten diese doch eine Reihe von Vorteilen.
Zwar können Menschen eine gewisse Widersprüchlichkeit innerer Überzeugungen aushalten: man nennt diese Fähigkeit „Ambiguitätstoleranz“. Aber das Management solcher Spannungen – so zeigt die Forschung zur „Kognitiven Dissonanz“ – kostet eine gewisse Energie: Unsere inneren Bewertungssysteme streben daher nach einer möglichst großen Konsistenz. Für einen rational orientierten Menschen könnte es sich daher aus pragmatischen Gründen anbieten, auf irrationale Sinnquellen zu verzichten.
Auch auf gesellschaftlicher Ebene bergen Sinnquellen, die auf irrationale, jenseitige oder mystische Aspekte verzichten, ein paar handfeste Vorteile: Menschen die auch ihre emotionalen WELTZUGÄNGE im Bereich eines rational-empirischen Weltverständnisses suchen und finden, sind vermutlich eher ansprechbar für die wissenschaftlichen Sichtweisen und Argumente, die wir zur Lösung der großen Menschheits-Herausforderungen so dringend benötigen. Menschen, die ihre Erfüllung im Diesseits finden sind sehr wahrscheinlich eher in der Lage, sich auf der Basis von Erkenntnissen und Vernunft auch über Nationen und Kulturen hinweg auf gemeinsame „objektive“ Realitäten und logische Lösungswege zu einigen.
Das täte unserer chaotischen Welt ganz sicher sehr gut!
Zum Weiterdenken
Welche Ihrer Sinnquellen ist Ihnen beim Lesen (oder Hören) des Textes als erstes in den „Sinn“ gekommen? Kam Ihr persönlicher Favorit in der Aufzählung überhaupt vor?
Wieviel Aufmerksamkeit und Zeit widmen Sie in Ihrem Alltagsleben den sinngebenden Themen bzw. Tätigkeiten? Gäbe es eine Möglichkeit, das auszubauen? Wer oder was hindert Sie daran?

Vorläufer-Themen
Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?
Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?
Parallel-Themen
In welchen Bereichen sucht (und findet) der Mensch tiefe Erfahrungen, inneren Frieden oder Zugehörigkeit, die über die alltäglichen und materiellen Aspekte des Lebens hinausgehen?
Welche Rolle kann die Bindung an ein religiöses Glaubenssystem in unserem Leben spielen? Welche Verbindungen gibt es zwischen Religion und gesellschaftlichen Fragen – auch bedenkliche?
In welchen besonderen Lehren und Praktiken suchen Menschen Erfahrungen bzw. Erkenntnisse, die außerhalb der rational-empirischen Weltzugänge liegen? Wie sind die Folgen einzuschätzen?
Nachfolge-Themen
Wie sind die unterschiedlichen WELTZUGÄNGE hinsichtlich der anstehenden Gestaltungsfragen zu beurteilen?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
SCOBEL über Sinn des Lebens
Kompakt und strukturiert wie immer: Die Sinnfrage wird gestellt – aber die Antwort bleibt (natürlich) offen:
Einen objektiven Sinn gibt es eben nicht…
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- WELTZUGÄNGE: Der Bereich der menschlichen Begegnung mit der Welt, der über reines Wissen und Erkenntnis hinausgeht und emotionale, hoffende, suchende, staunende und glaubende Aspekte einschließt.
- Neo-Cortex (Großhirn): Der evolutionär jüngste Teil des Gehirns, der für höhere kognitive Funktionen wie abstraktes Denken, Selbstreflexion und komplexe soziale Interaktionen zuständig ist.
- Resonanz-Beziehungen: Ein Begriff aus der Soziologie (Hartmut Rosa), der das menschliche Bedürfnis beschreibt, sich in einer Welt zu befinden, die ein „Echo“ oder eine „Antwort“ auf das eigene Sein und Handeln gibt, jenseits von rein funktionaler Nutzung.
- Objektiver Lebenssinn: Die Vorstellung, dass der Sinn des Lebens unabhängig vom menschlichen Bewusstsein und seinen evolutionär bedingten Fähigkeiten existiert und vorgegeben ist.
- Selbstentfaltung: Eine Sinnquelle, die auf der Verwirklichung der individuellen Potenziale, Begabungen und Fähigkeiten basiert, oft als zentrales Lebensziel empfunden.
- Erkenntnis: Eine Sinnquelle, die auf dem Bedürfnis basiert, Wissen und Verständnis über die Welt zu erlangen, wobei der Prozess des Erkennens selbst als erfüllend betrachtet wird.
- Altruismus: Eine Sinnquelle, die auf selbstlosem Handeln für andere basiert und in vielen Kulturen und Epochen als Weg zur Erfüllung betrachtet wird.
- Beziehungen: Eine fundamentale Sinnquelle, die in den intensiven persönlichen Verbindungen zu Familie, Freunden, Partnern und anderen Menschen gefunden wird.
- Spuren hinterlassen: Eine Sinnquelle, die im Bedürfnis liegt, etwas Bleibendes zu schaffen oder zu bewirken, das über die eigene Lebensspanne hinausgeht, sei es materiell oder immateriell.
- Jenseitigkeit: Eine Sinnquelle, die sich auf spirituelle, transzendente, religiöse oder esoterische Erfahrungen und Glaubenssysteme bezieht, die über die weltliche Realität hinausgehen.
- Hedonismus: Eine Sinnquelle, die auf der Suche nach Lustgewinn, Genuss und persönlichem Glück basiert, wobei das bewusste Erleben von Freude als Baustein für ein erfülltes Leben betrachtet werden kann.
- Ambiguitätstoleranz: Die Fähigkeit, Widersprüche oder Unklarheiten in inneren Überzeugungen auszuhalten.
- Kognitive Dissonanz: Ein psychischer Zustand, der auftritt, wenn widersprüchliche Überzeugungen oder Einstellungen bestehen und der oft als unangenehm empfunden wird.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Was bedeutet der Begriff „WELTZUGÄNGE“ im Kontext des Textes?
- Welche Rolle spielt das wachsende Großhirn laut Text für die menschliche Sinnsuche?
- Wie beschreibt der Soziologe Hartmut Rosa das menschliche Bedürfnis, das im Text als „Resonanz-Beziehungen“ bezeichnet wird?
- Warum wird im Text die Vorstellung eines objektiven Lebenssinns als absurd betrachtet?
- Nennen Sie drei der sieben im Text diskutierten Sinnquellen.
- Welche Schattenseiten kann das Bedürfnis zur Selbstentfaltung haben?
- Was bedeutet es im Kontext der Erkenntnis als Sinnquelle, dass der Erkenntnisfortschritt sein Ziel in sich selbst trägt?
- Wie wird im Text der Gedanke kritisiert, dass Altruismus nur eine Form des Egoismus sei?
- Warum wird in modernen westlichen Gesellschaften der Individualismus im Kontext von Beziehungen als bedenkliche Entwicklung betrachtet?
- Welchen pragmatischen Vorteil könnte es laut Text für einen rational orientierten Menschen haben, auf irrationale Sinnquellen zu verzichten?
Kommentare zu dieser Seite
(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).






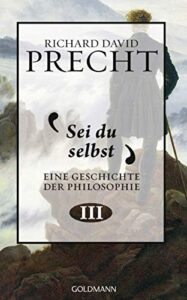

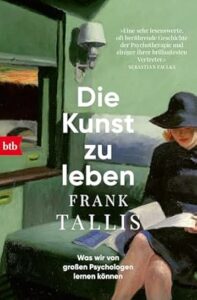
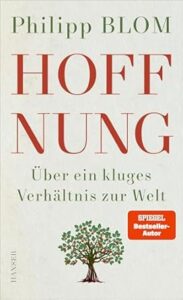
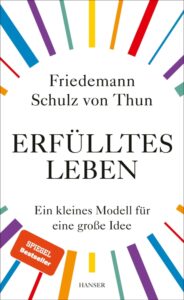
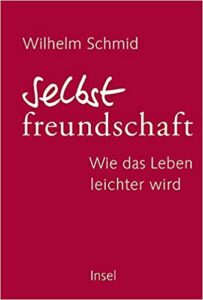
Schreibe einen Kommentar