Der Rote Faden
Nach der Logik in diesem Projekt sollte sich die GESTALTUNG unserer Gesellschaft aus den WELTERKLÄRUNGEN ableiten lassen.
Mit dem Thema Transgender befinden wir uns in einem besonders umstrittenen Teilbereich der Gestaltung von gesellschaftlichen Umgangsregeln.
Im Fokus steht hier eine Minderheit, die mit ihren Sichtweisen und Forderungen an einem der wichtigsten Fundamente unseres Zusammenlebens rüttelt: der Definition von Weiblichkeit und Männlichkeit.
Damit stellt sich unmittelbar die Frage, ob, in welchem Umfang und in welcher Richtung die Erkenntnisse aus den Wissenschaften zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen beitragen können. Das ist in diesem Fall besonders spannend, weil sich bei diesem Thema möglicherweise die Perspektiven verschiedener Wissenschaften widersprechen könnten: Was würde es bedeuten, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht im Einklang ständen mit sozialwissenschaftlichen Gender-Studies (bzw. umgekehrt)?
Verbindungen gibt es daher zu den Kapiteln Wissenschaft und Menschenbildern, innerhalb des Bereichs WELTGESTALTUNG insbesondere zum Kapitel Minderheiten.
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Die im Test enthaltenen 7 Dimensionen versuchen in abgestufter Form, zwei Bereiche zu erfassen: Die Vorstellung davon, wodurch die eigene Geschlechtlichkeit definiert wird, und die Haltung gegenüber den Forderungen der Transgender-Community.
Schauen wir genauer hin:
Vorlesen lassen
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Was definiert unsere Geschlechtlichkeit?
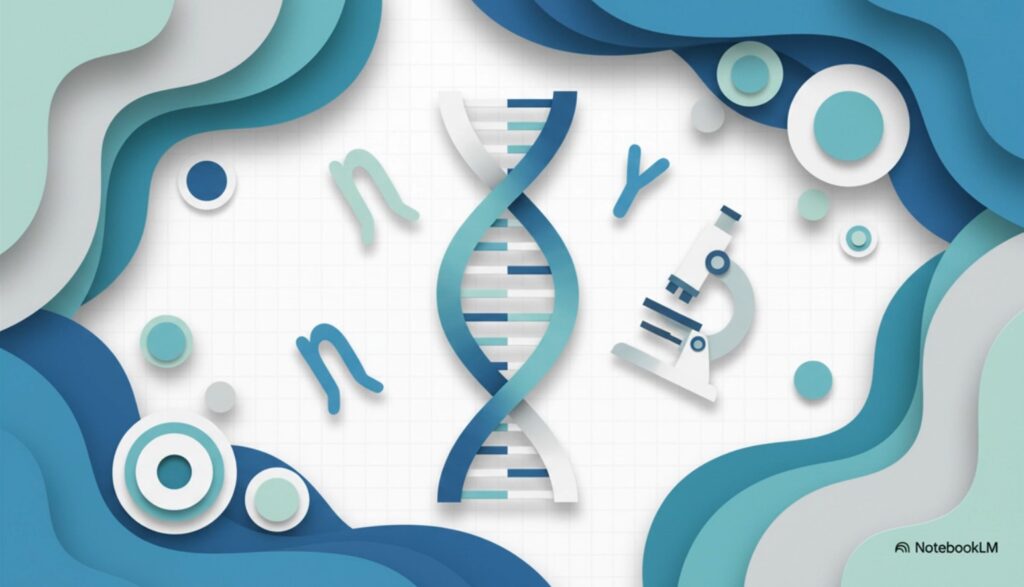
Starten wir mit der Biologie
Gelegentlich fangen Gespräche über Transsexualität damit an, dass die binäre Zweigeschlechtlichkeit beim Menschen (oder gleich bei allen Säugetieren) in Zweifel gezogen wird. Angeblich sei die binäre Sichtweise eine Vereinfachung eines hochkomplexen Prozesses, in dem es viele Unklarheiten und Zwischenstufen gäbe und es relativ häufig zu übergriffigen Zuschreibungen eines bestimmten Geschlechtes komme.
Tatsächlich kommt es nur bei ca. 1:3000 Geburten (also ca. 0,03%) zu einer Störung der Geschlechtsentwicklung (DSD: Disorders of Sex Development). Während früher häufiger eine schnelle (hormonelle oder operative) Intervention mit dem Ziel erfolgte, eine größere Eindeutigkeit der Geschlechtszuweisung zu erzielen, wird damit seit ca. 20 Jahren sehr zurückhaltend umgegangen. Das soll später eine maximal mögliche Mitbestimmung der Betroffenen ermöglichen.
In allen anderen Fällen (99,97%) ist bei Transgender-Personen das biologische Geschlecht genauso eindeutig festgelegt wie bei allen anderen Menschen; von einer – mehr oder weniger willkürlichen – Zuschreibung eines Geschlechts durch Mediziner (oder Hebammen oder Eltern) kann daher keine Rede sein. Hier wird also auch niemand – wie es die Aktivistensprache nahelegt – als männlich oder weiblich „gelesen“; der Säugling ist schlichtweg männlich bzw. weiblich.
Die Entwicklung inkongruenter Geschlechtsidentität
Bei ca. 1% der Menschen entstehen bis zum Erwachsensein Diskrepanzen zwischen dem biologischen und dem empfundenen Geschlecht; ein großer Teil von ihnen gibt an, das schon in der Kindheit so empfunden zu haben.
Es gibt tatsächlich zunehmend wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Transgender-Neigungen neurologische Grundlagen haben, die bereits früh in der Entwicklung erkennbar sein können. Studien haben gezeigt, dass die Hirnaktivität und -struktur von Transgender-Jugendlichen Ähnlichkeiten mit dem Geschlecht aufweisen, das ihrer gefühlten geschlechtlichen Identität entspricht.
Auch wenn diese Forschungen noch am Anfang stehen, können sie doch als Hinweis darauf gewertet werden, dass „echte“ Transgender-Verläufe auch biologisch untermauert werden können.
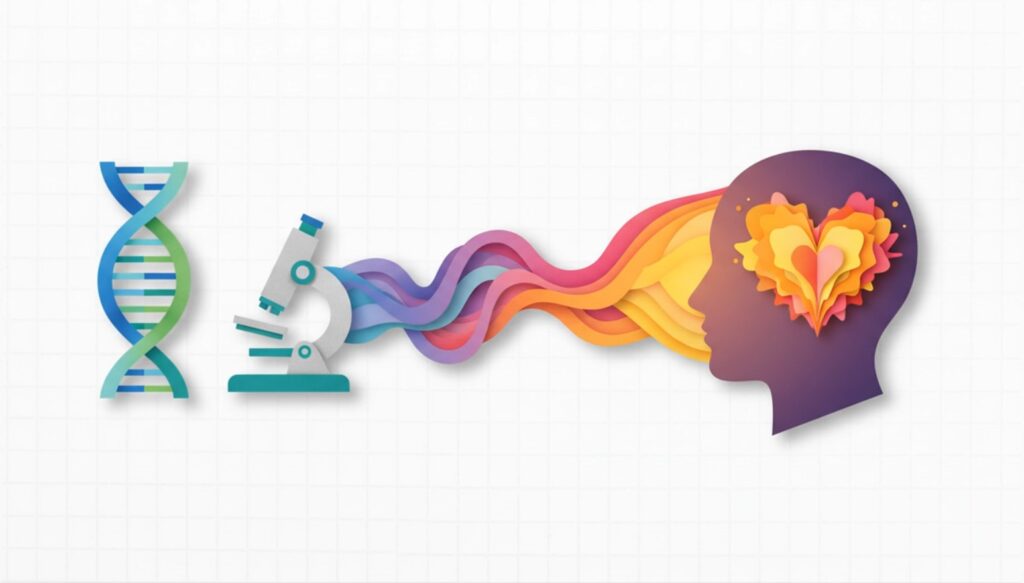
Auf der anderen Seite ist unbestreitbar, dass sich in den letzten Jahren rund um die Transgender-Thematik eine gesellschaftliche Bewegung und ein medialer Hype entwickelt hat. Während es für eine Gruppe von jungen Leuten „im Trend“ liegt, mit ihrer Geschlechtsidentität ein wenig zu „spielen“ (ähnlich wie ihre Influencer bei Instagram oder TikTok) bietet die Transgender-Thematik den Jugendlichen, die sich – pubertätstypisch – mit ihrer Identitätsfindung abmühen – eine Art neuer Heimat. Auch eine starke emotionale Identifikation mit Einzelschicksalen von diskriminierten (oder sogar physisch angegriffenen) Transpersonen kann die Bereitschaft fördern, sich zu diesem Thema hin auch persönlich zu öffnen. Hier kommen dann auch die Aufklärungs- und Beratungsangebote der Transgender-Community ins Spiel: Die Gefahr besteht, dass hier nicht ergebnisoffen informiert wird, sondern von Betroffenen Lobbyarbeit im Sinne der Aktivisten-Szene betrieben wird.
Über die Frage, ob es (noch) legitim sei, das dauerhafte Fremdfühlen im eigenen biologischen Körper als eine (krankheitswerte) Störung zu bezeichnen, wird weiter gestritten. In solchen sensiblen Bereichen können Konflikte zwischen fachlichen und gesellschaftlich-kulturellen Perspektiven entstehen.
Ob die Anpassung fachlicher Kriterien an den Druck des Zeitgeistes immer die optimale Entscheidung darstellt, darf wohl bezweifelt werden. So wie beim Festhalten der Biologie am Prinzip der Gleichgeschlechtlichkeit dürfte m.E. die – einen Leidensdruck auslösende – Diskrepanz zwischen Geschlecht und Gender auch weiterhin als eine psychische Störung betrachtet werden. Das hätte ja – wie bei anderen Störungen auch – überhaupt nichts mit gesellschaftlicher Toleranz und Akzeptanz zu tun: Warum sollte eine solche Diagnose auf einmal als Diskriminierung empfunden werden – wenn man gleichzeitig für den vorurteilsfreien Umgang mit allen psychischen Erkrankungen kämpft?
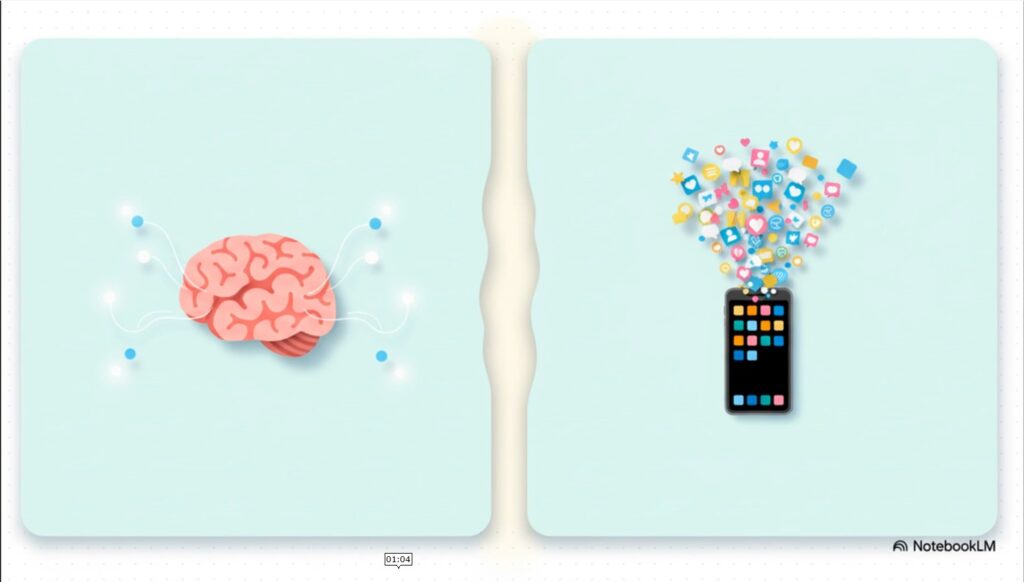
Geschlechtsrollen und Transgender
Insbesondere in feministischen Kreisen wird zunehmend Folgendes kritisiert: Immer mehr Mädchen und junge Frauen, die unter dem Einfluss rigider Geschlechtsrollen-Klischees leiden, wählen aktuell eher den Transgender-Weg als den Kampf für eine Befreiung von diesen Beschränkungen. Damit – so wird argumentiert – schwächten sie nicht nur den Feminismus, sondern gingen das Risiko ein, schwerwiegende Fehlentscheidungen hinsichtlich ihrer sexuellen Entwicklung und Selbstverwirklichung zu fällen. Das ist bedenkenswert und nachvollziehbar.
Auf der individuellen Ebene kann die Aufweichung der – als einschränkend und aufgezwungen empfundenen – Geschlechtsidentitäten trotzdem manchmal ein willkommener Ausweg sein. Nicht jeder pubertärer Entschluss, „ab sofort kein Mädchen mehr sein zu wollen“, führt ja auf den Weg zu einer Geschlechtsumwandlung (Transition).
Trotzdem sollte man insgesamt anstreben, dass Jugendliche sich ermutigt fühlen, ihre persönliche Identitäts-Ausgestaltung zunächst einmal innerhalb ihrer biologischen Geschlechtlichkeit zu suchen (was ja auch weiterhin die Regel ist).
Welche Regeln sollten gelten?
Umgang mit den Betroffenen

Bestimmte Regeln erscheinen selbstverständlich: Kein Betroffener wird benachteiligt oder diskriminiert; es besteht ein Schutz vor jeglichen Formen von An- oder Übergriffen.
In Bezug auf die Unterstützung im medizinischen und psychologischen Bereich sollten die üblichen Standards der Gesundheitsversorgung gelten. Entsprechende fachliche Standards liegen vor. So wie in anderen Leistungsbereichen auch, sollte erwartet werden, dass die Notwendigkeit und Angemessenheit von Versicherungsleistungen fachlich eingeschätzt und geprüft werden. Bevor z.B. operative Maßnahmen zur Geschlechtsumwandlung durchgeführt (und finanziert) werden, wäre zu prüfen, ob der Leidensdruck des Antragstellers nicht durch andere Ursachen hervorgerufen werden bzw. beseitigt werden können.
In Bezug auf Kinder und Jugendliche besteht eine besondere Fürsorgepflicht des Staates, die – wegen der Tragweite der anstehenden Entscheidungen – durchaus auch die Selbstbestimmungsrechte junger Menschen begrenzen dürften. Eine fachliche Prüfung sollte unabhängig, ergebnisoffen und neutral erfolgen.
Umgang mit den Forderungen der Aktivisten
Noch viel kontroverser als die Einzelfälle ist die Frage, in welchem Ausmaß diese Minderheit Anspruch darauf hat, aus Gründen des Schutzes, der Fairness oder des Respekts auch generelle gesellschaftliche Regeln zu verändern. Muss eine Mehrheitsgesellschaft – weil es das Phänomen Transgender gibt – seine sprachlichen und formalen Gewohnheiten anpassen, weil diese nur den „Normalfall“ (also die Übereinstimmung von Geschlecht und Genderidentität) abbilden? Müssen sich z.B. 99% der Menschen explizit als „cis“ (binär-zweigeschlechtlich) beschreiben, weil sich sonst das restliche eine Prozent nicht repräsentiert fühlt? Muss in jedem sozialen Kontakt zu Beginn ein Abgleich über die benutzten Personalpronomen erfolgen – oder reicht es aus, dass ein Betroffener bei Bedarf selbst darauf aufmerksam macht? Müssen für Transmänner „Väterpässe“ hergestellt und ausgegeben werden – nachdem ihr biologisch weiblicher Körper ein Kind zur Welt gebracht hat? Müssen schon Kinder darüber aufgeklärt werden, dass männlich und weiblich keine eindeutigen Konzepte sind? Müssen langfristig alle öffentlichen Toiletten-Anlagen umgebaut werden?
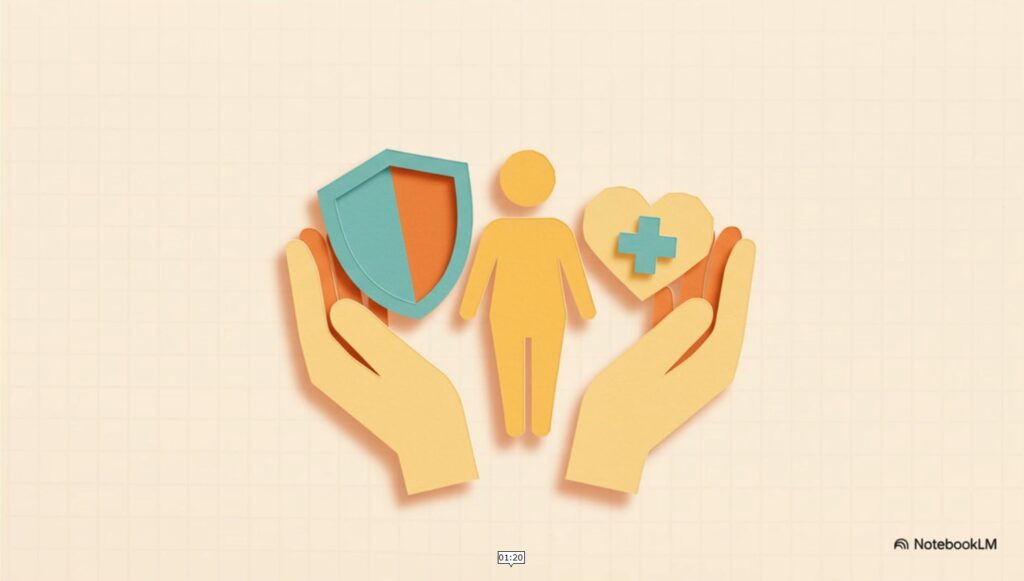
Obwohl vielleicht auch sehr wohlmeinende Menschen da innerlich die Augen verdrehen, wird dann häufig gesagt: „Seien wir doch einfach tolerant und großzügig! Für die Betroffenen scheint das sehr wichtig zu sein, und uns kostet es doch (fast) nichts.“
Aber stimmt das?
Damit meine ich nicht nur die notwendigen baulichen Investitionen. Hat es denn tatsächlich keinen Preis, immer weiter an den selbstverständlichen Grundlagen des Alltagslebens zu rütteln? Für die meisten Menschen ist das moderne Leben schon längst viel zu kompliziert und undurchschaubar geworden. Wie reagieren sie, wenn selbst so existentielle Konzepte wie die Geschlechtszugehörigkeit in Frage gestellt werden? Einige schütteln nur den Kopf und grummeln vor sich hin. Aber viele andere gehen in den Widerstand und drücken ihr Unverständnis und ihre Wut durch eine Hinwendung zu rechts-populistischen Parteien aus. So gibt es die begründete Annahme, dass die Wahlergebnisse von Trump oder der AfD ohne die radikalen Aspekte der Transgender-Diskussion niedriger ausgefallen wären.
Und die Wissenschaft?
Wie kann bei diesem Thema die Wissenschaft helfen?
Zunächst müsste sich die Wissenschaft selber ernst nehmen: Sie müsste z.B. Versuche abwehren, aus der Naturwissenschaft Biologie eine Sozial- bzw. Kulturwissenschaft machen zu lassen, in der dann die biologischen Konzepte von Geschlechtlichkeit weitgehend relativiert werden.
Versteht und betreibt man jedoch die Biologie weiter als Naturwissenschaft, kann die Frage der binäre Zweigeschlechtlichkeit als beantwortet gelten.

Die Frage der gesellschaftlichen GESTALTUNG des Umgangs mit Abweichungen und Belastungen kann dann ebenfalls wissenschaftlich bzw. fachlich begleitet werden. Hier spielen einerseits auf Einzelfallebene Diagnostik, Beratung, Psychotherapie und medizinische Maßnahmen eine entscheidende Rolle (neben der parteilichen Unterstützung durch Anlaufstellen der Betroffenen-Initiativen).
Eine weitere Erforschung der medialen Einflüsse auf das deutliche Ansteigen von Transgender-Fragestellungen wäre dringend geboten – auch um aufklärend dagegen wirken zu können. Die Informationshoheit in die Hände der Betroffenen-Verbände zu legen, wäre mehr als leichtfertig.
Die empirische Sozialforschung kann auch Beiträge zu der gesellschaftlichen Abwägung leisten – zwischen der Berücksichtigung von Bedürfnissen und Interessen von Betroffenen und den ebenfalls legitimen Interessen der Mehrheitsgesellschaft an einer Aufrechterhaltung eines vertrauten kulturellen Rahmens. Man sollte schlichtweg wissen, mit welchen Folgen man rechnen muss, wenn man einen Großteil der Bevölkerung verunsichert und überfordert.
Auf einer eher abstrakten Ebene wäre psychologisch, anthropologisch oder philosophisch zu reflektieren, welche generellen Trends sich in dem Transgender-Hype abbilden könnten. Zeigt sich auch in diesem Bereich eine (übersteigerte) Tendenz zur Individualisierung und Singularisierung? Noch dem Motto: Je seltener und ausgefallener meine Geschlechtsidentität ist, desto mehr Selbstwert kann ich daraus ziehen!
Oder manifestiert sich im Bereich der Geschlechtlichkeit ein allgemeiner „Machbarkeitswahn“: Nichts kann mir Grenzen setzen; alles ist möglich!
Resümee
Bei aller kritischen Analyse: Es soll am Ende noch einmal daran erinnert werden, dass ein großer Teil der Transmenschen eine extrem belastende Leidensgeschichte und z.T. dramatische Diskriminierungserfahrungen ertragen mussten (und müssen). Sie alle – auch die noch auf der Suche nach ihrem Weg sind – haben Anspruch auf Schutz, Solidarität und Hilfestellung.
Das heißt aber eben nicht, dass die Transcommunity das Recht hätte, der Mehrheitsgesellschaft völlig neue Sichtweisen oder Sprach- bzw. Verhaltensregeln aufzuerlegen. Das geht leider nach hinten los…
Bei den jungen Leuten gilt es, sorgfältig abzuwägen:
Sie müssen einerseits davor geschützt werden, ohne fachliche Begleitung und Beratung weitreichende Schritte einzuleiten. Auf der anderen Seite verdienen sie auch eine Portion entspannte Toleranz, wenn es darum geht, in der Phase der Identitätssuche auch mit der eigenen Geschlechtsidentität ein wenig zu experimentieren.
Die (relativ) große Bereitschaft dieser Altersgruppe, sich lautstark für die LGBTIQ*-Szene (und andere Minderheiten) zu engagieren kann vielleicht auch als ein nachvollziehbarer Impuls betrachtet werden, der überall spürbaren zahlenmäßigen und machtmäßigen Dominanz der Älteren in unserer Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Aus ihrer Sicht wurde und wird ihnen durch die Boomer eine Menge zugemutet – dann darf man auch mal mit Zumutungen antworten…
Zum Weiterdenken
Sind Sie persönlich schon einmal mit dem Phänomen „Transgender“ in Berührung gekommen? Wenn ja: Was hat das in Ihrer Haltung verändert?
Könnten Sie sich vorstellen, dass eines Ihrer Kinder sich plötzlich mit dem anderen Geschlecht identifizieren könnte? Würden Sie es auf Wunsch mit einem anderen Namen ansprechen?
Wie weit würden Sie den Forderungen der Transgender-Aktivisten entgegenkommen? Sollte sich die Gesellschaft weitgehend auf die Bedürfnisse dieser kleinen Minderheit ausrichten?
Denken Sie wirklich, dass es mehr als die üblichen zwei Geschlechter gibt?

Vorläufer-Themen
Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?
Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?
Wie sind die unterschiedlichen WELTZUGÄNGE hinsichtlich der anstehenden Gestaltungsfragen zu beurteilen?
Parallel-Themen
Wieviel Rücksicht und Entgegenkommen schuldet unsere Gesellschaft den diversen Minderheits-Gruppen?
Sollten sich Staat und Gesellschaft wirklich bzgl. Weltanschauungen und Wertesysteme neutral verwalten? Sollte es ein „freies Spiel der Kräfte“ geben – jede/r sucht sich etwas aus?
Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?
Nachfolge-Themen
Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
Marie-Luise Vollbrecht bei KOSUBEK
Die „gecancelte“ Biologin über die Auseinandersetzung um die Zweigeschlechtlichkeit. Die Diskussion beleuchtet Perspektiven auf die Geschlechterordnung und die damit verbundenen ideologischen Ideen im Kontext des Selbstbestimmungsgesetzes und des Feminismus.
Falschdiagnose oder Identität? Die Realität junger Transmenschen!
Eindringliche Dokumentation aus Sicht von mehreren Betroffenen.
Richard DAWKINS und Kathleen STOCK (auf Englisch)
Ein ruhiges und konzentriertes Gespräch über verschiedene Aspekte der Transgender-Fragestellung.
Kathleen STOCK (auf Englisch)
Sie diskutiert, wie sich das Verständnis von Geschlecht verändert hat und kritisiert die Neigung, Geschlecht rein von inneren Identitäten abzuleiten. Ihr Standpunkt, dass nicht alle Transfrauen als Frauen und nicht alle Transmänner als Männer anerkannt werden können, wird heftig angefeindet.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- Welterklärung: Der Prozess oder Bereich des Verstehens und Erklärens der Welt und ihrer Phänomene, oft im naturwissenschaftlichen Kontext.
- Weltgestaltung: Der Prozess oder Bereich des bewussten Beeinflussens und Gestaltens der Welt, oft im gesellschaftlichen, politischen oder ethischen Kontext.
- Weiblichkeit/Männlichkeit: Fundamentale Konzepte des Zusammenlebens, deren Definition durch die Transgender-Thematik herausgefordert wird.
- Naturwissenschaften: Ein Bereich, dessen Erkenntnisse laut Text zur Beantwortung von Fragen rund um Transgender beitragen können, wobei mögliche Widersprüche zu sozialwissenschaftlichen Gender-Studies diskutiert werden.
- Sozialwissenschaftliche Gender-Studies: Ein Bereich, dessen Perspektiven laut Text möglicherweise im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen stehen könnten.
- Binäre Zweigeschlechtlichkeit: Die in der Biologie als beantwortet geltende Vorstellung, dass es beim Menschen (und den meisten Säugetieren) zwei eindeutige biologische Geschlechter gibt.
- Störungen der Geschlechtsentwicklung (DSD): Eine seltene Bedingung (ca. 0,03%), bei der es zu einer Störung der biologischen Geschlechtsentwicklung kommt.
- Geschlechtsidentität: Das empfundene Geschlecht einer Person, das bei Transgender-Personen von ihrem biologischen Geschlecht abweichen kann.
- Inkongruente Geschlechtsidentität: Eine Diskrepanz zwischen dem biologischen und dem empfundenen Geschlecht.
- Neurologische Grundlagen: Wissenschaftliche Hinweise, die darauf hindeuten, dass Transgender-Neigungen biologisch untermauert sein könnten, z.B. durch Ähnlichkeiten in Hirnaktivität und -struktur.
- Aktivisten/Transgender-Community: Eine Gruppe, deren Forderungen und Einfluss auf die gesellschaftliche Gestaltung im Text kontrovers diskutiert werden.
- Geschlechtsrollen: Kulturell geprägte Erwartungen und Verhaltensweisen, die laut feministischer Kritik dazu führen können, dass junge Frauen den Transgender-Weg wählen, anstatt für ihre Befreiung zu kämpfen.
- Transition/Geschlechtsumwandlung: Der Prozess der Anpassung des äußeren Erscheinungsbildes und manchmal des Körpers an die Geschlechtsidentität.
- Fürsorgepflicht des Staates: Die Verantwortung des Staates, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, sorgfältig abzuwägen und Schutz zu bieten, insbesondere bei weitreichenden Entscheidungen wie einer Transition.
- Cis (binär-zweigeschlechtlich): Eine Bezeichnung für Personen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem biologischen Geschlecht übereinstimmt.
- Sprachliche/formale Gewohnheiten: Gesellschaftliche Normen und Ausdrucksweisen, deren Anpassung an die Bedürfnisse der Transgender-Minderheit im Text kontrovers diskutiert wird (z.B. Personalpronomen).
- Rechtspopulistische Parteien: Politische Gruppierungen, deren Wahlergebnisse laut einer Annahme im Text durch die radikalen Aspekte der Transgender-Diskussion beeinflusst werden könnten.
- Empirische Sozialforschung: Ein Bereich, der Beiträge zur gesellschaftlichen Abwägung zwischen den Bedürfnissen von Minderheiten und den Interessen der Mehrheitsgesellschaft leisten kann.
- Individualisierung/Singularisierung: Mögliche übergeordnete Trends, die sich laut psychologischer, anthropologischer oder philosophischer Reflexion im „Transgender-Hype“ abbilden könnten.
- Machbarkeitswahn: Eine mögliche Tendenz, die sich laut Reflexion im Bereich der Geschlechtlichkeit manifestieren könnte, basierend auf der Vorstellung, dass „alles möglich“ ist.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Was bedeutet das biologische Geschlecht bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen laut Text?
- Wie häufig treten Störungen der Geschlechtsentwicklung (DSD) laut Text auf?
- Welche wissenschaftlichen Hinweise auf die Grundlagen von Transgender-Neigungen werden im Text erwähnt?
- Welche gesellschaftlichen Entwicklungen rund um das Thema Transgender werden kritisch beleuchtet?
- Warum wird im Text die Debatte um die Bezeichnung der Diskrepanz zwischen biologischem Geschlecht und empfundenem Gender als „psychische Störung“ angesprochen?
- Welche Kritik wird laut Text in feministischen Kreisen bezüglich Transgender laut?
- Welche grundlegenden Regeln im Umgang mit Transgender-Personen erscheinen dem Autor selbstverständlich?
- Warum sollte bei Kindern und Jugendlichen laut Text eine besondere Fürsorgepflicht des Staates gelten?
- Welche potenziellen gesellschaftlichen Folgen der Forderungen der Transgender-Aktivisten werden im Text genannt?
- Was sollte die Wissenschaft laut Text tun, um bei diesem Thema hilfreich zu sein?
Kommentare zu dieser Seite
Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.
Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?
Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.






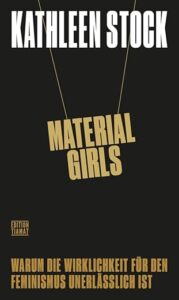
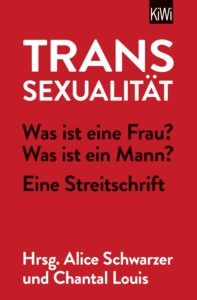
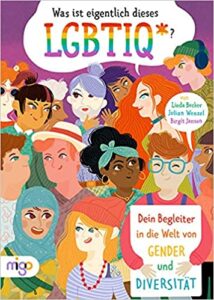
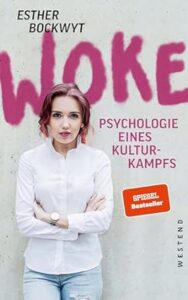
Schreibe einen Kommentar