Der Rote Faden
Die Definition und Ausgestaltung von individuellen Freiheitsrechten in unserer Gesellschaft ist ein zentralen Thema in der ideologischen und politischen Auseinandersetzungen. Beteiligt sind dabei Grundüberzeugungen, die sich aus denen im Bereich WELTERKLÄRUNG und WELTZUGÄNGE diskutierten Themen ableiten lassen: Allgemein geht es dabei um „Menschenbilder“, speziell um „Ichwerdung“ und „Lebenslenkung“.
Eng verknüpft mit der Freiheits-Diskussion sind die Themen „Pluralismus“ und „Individualismus“.
(Alle Links finden sich weiter unten auf dieser Seite).
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Welche Freiheit meinen wir?
Vorlesen lassen
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Es soll hier nicht um die sogenannte negative Freiheit gehen – also die Abwesenheit von äußerem Zwang, Unterdrückung oder Sklaverei. Diese Form von Freiheit betrachten wir als unstrittige Grundlage jeder humanen Gesellschaft.
Im Mittelpunkt steht hier die Frage nach den individuellen „bürgerlichen“ Freiheitsrechten – also nach dem Ausmaß, in dem persönliche Lebensentwürfe gesellschaftlich ermöglicht, geschützt oder sogar gefördert werden.
In unserer kapitalistisch geprägten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wird häufig ein enger Zusammenhang zwischen politischen Freiheitsrechten (wie Meinungs-, Versammlungs-, Presse- oder Religionsfreiheit) und einer möglichst freien wirtschaftlichen Betätigung behauptet. Letztere schließt insbesondere Vertragsfreiheit und Eigentumsschutz ein.
Gleichzeitig zeigt sich gerade in der Wirtschaft, dass unsere Gesellschaft gewisse Begrenzungen und Regulierungen für unverzichtbar hält – zusammengefasst im Modell der Sozialen Marktwirtschaft: Kartellrecht, Mitbestimmung, Sozialpartnerschaft und – zumindest theoretisch – eine Gemeinwohlbindung des Eigentums sind etablierte Prinzipien.

Freiheit im politischen Koordinatensystem
Innerhalb des politischen Spektrums lässt sich gut beobachten, wie unterschiedlich die Gewichtung zwischen individueller Freiheit und staatlicher Rahmensetzung ausfällt. Eine konservativ-liberale Perspektive betont eher die Eigenverantwortung und fordert vom Staat Zurückhaltung. Auf der linken Seite des Spektrums wird Freiheit stärker als etwas verstanden, das erst durch gerechte Ausgangsbedingungen ermöglicht werden muss – auch durch Eingriffe in wirtschaftliche Machtverhältnisse und gezielte Förderung benachteiligter Gruppen.
Vor diesem Hintergrund war es kaum verwunderlich, dass das Thema „Freiheit“ in der Corona-Pandemie zu einem gesellschaftlichen Brennpunkt wurde. Dabei traten auch libertäre Strömungen verstärkt in Erscheinung, die einen extrem individualisierten Freiheitsbegriff vertreten – mit nur geringen Bezügen zu Gemeinwohl oder Solidarität. Überschneidungen mit rechts-populistischen Positionen waren dabei häufig.
Freiheit ist also kein neutraler, sondern ein ideologisch aufgeladener Begriff. Wer sich auf sie beruft, verfolgt oft handfeste Interessen: So wird die Forderung nach „weniger Staat“ regelmäßig dann laut, wenn es um die Begrenzung von Kapitalmacht, Steuervermeidung oder die Deregulierung von Arbeitsmärkten geht. Die Rhetorik der Freiheit dient in solchen Fällen der Legitimierung bestehender Ungleichheitsverhältnisse. „Freiheit“ meint dann: Freiheit von Umverteilung, von Verantwortung – und letztlich: Freiheit für die Stärkeren.
Die paradoxe Struktur der Freiheit

Aus der Evolutions- und Kulturgeschichte der Menschheit und aus der modernen Glücksforschung lassen sich gute Argumente dafür ableiten, dass die Überbetonung der Freiheitsoptionen des Individuums mit der sozialen Grundprägung des Menschen und seinen psychischen Grundbedürfnissen nicht gut im Einklang stehen. Maximal Freiheit heißt in modernen urbanen Gesellschaften oft auch maximal Vereinzelung bzw. Vereinsamung und chronische Überforderung durch ein Übermaß an Optionen hinsichtlich Konsumgütern, Lebenskonzepten und potentiellen Sinnquellen.
Die Angst, etwas zu verpassen oder eine falsche Wahl zu treffen, kann lähmend wirken. Die Kehrseite maximaler Freiheit ist häufig: Orientierungslosigkeit, innere Leere, Bindungsschwäche.
Diese Freiheit produziert keine Stabilität, sondern eine permanente Selbstbefragung, Selbstoptimierung und potenziell auch Selbstabwertung. Nicht wenige kompensieren diese Unsicherheiten durch die Hinwendung zu autoritären Strukturen – ein paradoxes Ergebnis einer vermeintlich „grenzenlosen“ Freiheit.
Maximal Freiheit ohne Einbindung in Gemeinschaft und soziale Verantwortung ist ganz sicher kein Weg zu einem erfüllten Leben. Viele der so hochgehaltenen Freiheiten (Konsum, Reisen, Ausleben von beliebigen Lebensvarianten) kompensieren eher die mangelnde Erfüllung psychischer und emotionaler Grundbedürfnisse, als dass sie ihnen dienen. Dass dahinter massive wirtschaftliche Interessen stehen, ist für jeden ersichtlich, der sich mit der Aufladung des Themas „Freiheit“ in der Werbung beschäftigt. Schon der gute alte Marlboro-Cowboy ließ grüßen…
Digitale Freiheit?
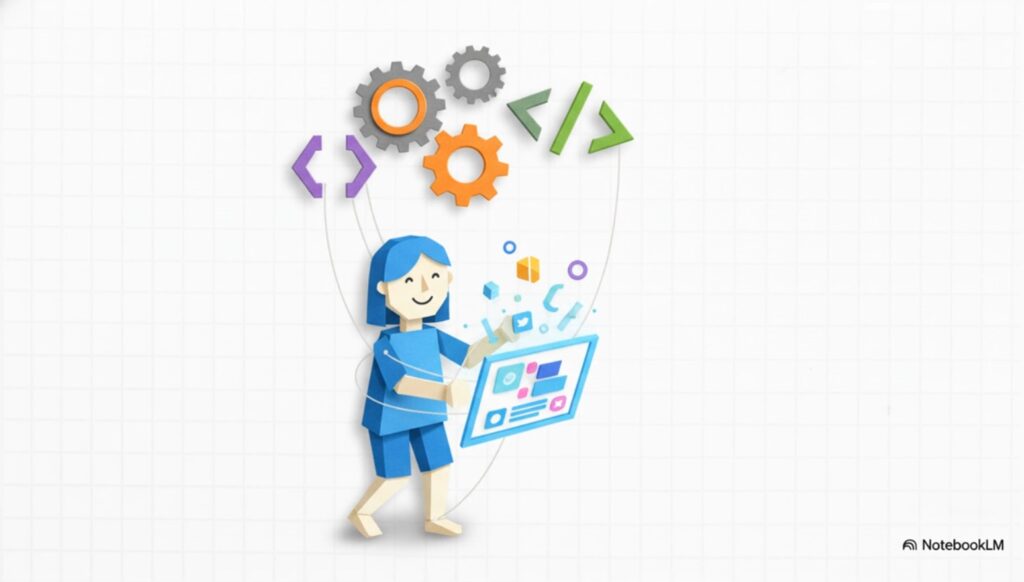
Die digitale Sphäre wird oft als Ort maximaler Freiheit gefeiert: freie Meinungsäußerung, globaler Austausch, Selbstverwirklichung. Tatsächlich aber geraten wir hier in neue Abhängigkeiten – von Algorithmen, Plattformlogiken und kommerziellen Interessen. Der digitale Raum ist kein neutraler Möglichkeitsraum, sondern ein hochreguliertes, datengetriebenes Ökosystem, das Verhalten lenkt, Bedürfnisse erzeugt und Aufmerksamkeit monetarisiert.
Gerade weil die Überwachung subtil und freiwillig erscheint, ist sie besonders wirksam: Wir glauben, frei zu handeln – und sind doch längst Teil eines kybernetischen Systems, das Freiheit in eine Ware verwandelt hat.
Freiheit und Menschenbild
Wie sieht es nun mit dem hier postulierten Zusammenhang zwischen einem rational-wissenschaftlichen Welt- und Menschenbild und dem Freiheitsthema aus?
Zunächst einmal lässt sich ja leicht nachvollziehen, dass ein großer Freiheitsspielraum (mit wenigen Begrenzungen und Regulierungen) vorrangig den Menschen zugute kommt, die aufgrund ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Ressourcen auch überdurchschnittliche Handlungsoptionen haben. Ein mit einem guten Begabungspotential ausgestatteter Mensch, dem in einer wohlhabenden und fördernden Familie eine solide Ausbildung und ein Netzwerk hilfreicher Beziehungen mit auf den Lebensweg gegeben wird, der wird einen fürsorgenden Staat kaum benötigen, dafür aber um so mehr von den individuellen Entfaltungsmöglichkeiten profitieren. Kein Wunder also, dass er mit Freiheit, Eigenverantwortung und Leistungsprinzip gut Freund ist.
Jetzt kommt das Menschenbild und die Wissenschaft ins Spiel: Wenn ich – im Widerspruch zu den Befunden der Sozialisationsforschung – davon ausgehe, dass dieser Weg zur persönlichen Nutzung der freiheitlichen Optionen jedem Menschen offensteht, kann ich das Scheitern in oder an der Freiheit einer privaten (Fehl-)Entscheidung bzw. einem persönlichen Versagen zuordnen. Wenn ich aber zur Kenntnis nehme, dass diese Stärken und Ressourcen, die das Nutzen der Freiheit erst so lohnend machen, auch ein Teil der Schicksals-Lotterie sind, kann das maximale Zelebrieren des Freiheits-Narrativs nicht die Antwort sein.
Freiheit und Gemeinschaft

Nicht jede Beschränkung von individuellen Rechten ist ein Ausdruck von Unterdrückung oder Willkür. Um Gemeinschaftsleben und Gemeinwohl zu fördern, müssen in einem zivilisierten Staat der Durchsetzung von persönlichen Interessen und Vorstellungen Grenzen gesetzt werden. Wenn die stärkeren gesellschaftlichen Gruppen in ihren Freiheiten nicht begrenzt würden, wären schnell die Freiheitsrechte der Schwächeren in Gefahr: z.B. das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, auf einen gerechten Anteil am gesellschaftlichen Reichtum, auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, auf die Sicherung der Grundbedürfnisse (Wohnen, Bildung, Gesundheitsversorgung, Mobilität, Kultur).
In weniger individualistischen Gesellschaften wird dem Kollektiv ganz traditionell und selbstverständlich eine größere Bedeutung und oft auch der Vorrang eingeräumt (s. Kapitel „Individualismus„). Das Ausmaß, in dem in westlichen Kulturen dem Egoismus des Einzelnen gefrönt wird, stößt in solchen kollektivistischen Gesellschaft auf großes Befremden.
Freiheit ist kein Selbstzweck, sondern steht in einem engen Spannungsverhältnis zur Demokratie. Demokratie lebt von Regeln, Verfahren und Kompromissen – sie verlangt vom Einzelnen die Bereitschaft zur Begrenzung des Eigeninteresses zugunsten des Gemeinwohls. Eine übersteigerte Vorstellung individueller Freiheit kann dieses Gefüge untergraben: Wenn jedes gesellschaftliche Regelwerk als illegitimer Eingriff in die eigene Lebensgestaltung verstanden wird, verliert Demokratie ihre Funktionsfähigkeit.
Gerade in pluralistischen Gesellschaften muss Freiheit immer auch eine geteilte Freiheit sein – eine, die auf der Anerkennung der gleichen Rechte und Bedürfnisse anderer basiert.
Fazit: Freiheit – aber wofür?
Was wäre eine konstruktive, realistische Form von Freiheit? Nicht die Freiheit zur Selbstinszenierung, zur Abgrenzung oder zur Konsummaximierung – sondern die Freiheit zur Teilhabe, zur Beziehung, zur Verantwortung.
Die Soziologie spricht hier von „resonanter Freiheit“ – eine Freiheit, die nicht in Isolation, sondern in Verbindung lebendig wird. Eine solche Freiheit setzt nicht auf Unabhängigkeit um jeden Preis, sondern auf Einbettung in sinnstiftende Kontexte, in Gemeinschaften, in Institutionen des Vertrauens.
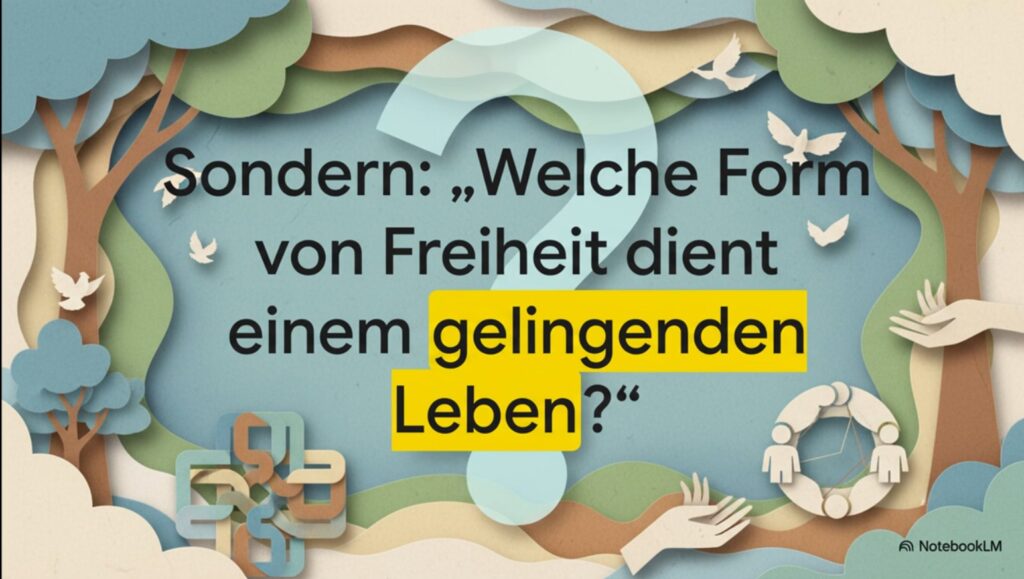
Die Leitfrage lautet nicht: Wie viel Freiheit ist möglich?, sondern: Welche Form von Freiheit dient dem gelingenden Leben – individuell und kollektiv?
Eine Freiheit, die zum Recht der Starken wird, die Vereinzelung und Gleichgültigkeit fördert, ist kein Fortschritt. Eine Freiheit aber, die durch faire Regeln, soziale Sicherheit, Bildung und demokratische Beteiligung getragen wird, kann den Menschen zu sich selbst und zu anderen führen. Nur in diesem Sinne ist Freiheit ein zivilisatorischer Fortschritt.
Zum Weiterdenken
Gibt es auch für Sie ein „Zuviel“ an Freiheit? In welchem Bereich empfinden Sie das am ehesten?
In welchen Lebensbereichen würden Sie sich eher noch mehr Freiheit wünschen? Haben sie sich schonmal dafür eingesetzt?
Wo wird in unserer Gesellschaft am häufigsten Freiheit missbraucht? Was sollte man dagegen tun?

Vorläufer-Themen
Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für unseren Lebensweg? Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand? Besteht letztlich alles nur aus Zufällen?
Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?
Parallel-Themen
Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?
Sollten sich Staat und Gesellschaft wirklich bzgl. Weltanschauungen und Wertesysteme neutral verwalten? Sollte es ein „freies Spiel der Kräfte“ geben – jede/r sucht sich etwas aus?
Welche Form der politischen Ordnung ist am ehesten in der Lage, die anstehenden Menschheitsprobleme zu lösen?
Nachfolge-Themen
Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
Ein ausführliches Erklärvideo
In diesem Video geht es um den Begriff der Freiheit, den Unterschied zwischen positiver und negativer, innerer und äußerer Freiheit (Willens- und Handlungsfreiheit).
Erklär-Video: Positive und negative Freiheit
Eine pfiffig und unterhaltsam gemachte Gegenüberstellung von verschiedenen Freiheitskonzepten.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- Negative Freiheit: Die Abwesenheit von äußerem Zwang, Unterdrückung oder Sklaverei. Wird im Text als unstrittige Grundlage einer humanen Gesellschaft betrachtet.
- Bürgerliche Freiheitsrechte: Individuelle Freiheitsrechte, die das Ausmaß betreffen, in dem persönliche Lebensentwürfe gesellschaftlich ermöglicht, geschützt oder gefördert werden.
- Soziale Marktwirtschaft: Ein Wirtschaftsmodell, das eine freie wirtschaftliche Betätigung mit staatlichen Regulierungen und sozialen Prinzipien (wie Kartellrecht, Mitbestimmung, Sozialpartnerschaft) verbindet.
- Gemeinwohlbindung des Eigentums: Das Prinzip, dass Eigentum nicht nur dem individuellen Nutzen dient, sondern auch dem Wohl der Gemeinschaft verpflichtet ist.
- Libertäre Strömungen: Politische Richtungen, die einen extrem individualisierten Freiheitsbegriff vertreten und nur geringe Bezüge zu Gemeinwohl oder Solidarität aufweisen.
- Menschenbild: Grundüberzeugungen über die Natur des Menschen, die sich auf das Verständnis und die Ausgestaltung von Freiheit auswirken.
- Ichwerdung: Der Prozess der individuellen Identitätsentwicklung und Selbstfindung.
- Pluralismus: Das Nebeneinander verschiedener Meinungen, Werte und Lebensentwürfe in einer Gesellschaft.
- Individualismus: Eine Orientierung, die das individuelle Sein und Wohlergehen im Vergleich zu den Interessen der Gemeinschaft in den Vordergrund stellt.
- Bindungsschwäche: Schwierigkeiten beim Aufbau und Erhalt stabiler zwischenmenschlicher Beziehungen.
- Autoritäre Strukturen: Gesellschaftliche oder politische Ordnungen, die durch starke hierarchische Kontrolle und geringe individuelle Freiheiten gekennzeichnet sind.
- Datengetriebenes Ökosystem: Ein System, das auf der Erhebung und Nutzung von Daten basiert, um Verhalten zu lenken und Bedürfnisse zu erzeugen, wie im digitalen Raum.
- Kybernetisches System: Ein System, das sich selbst reguliert und steuert, wobei Feedbackschleifen eine wichtige Rolle spielen; wird im Text im Zusammenhang mit der digitalen Überwachung verwendet.
- Schicksals-Lotterie: Die Vorstellung, dass bestimmte Stärken, Ressourcen und Gelegenheiten, die für den Erfolg bei der Nutzung von Freiheit wichtig sind, zufällig oder durch Umstände außerhalb der eigenen Kontrolle (z.B. Familie, Herkunft) gegeben sind.
- Kollektivistische Gesellschaft: Eine Gesellschaft, in der dem Kollektiv und den Interessen der Gemeinschaft traditionell eine größere Bedeutung und oft der Vorrang vor individuellen Interessen eingeräumt wird.
- Geteilte Freiheit: Eine Form von Freiheit, die auf der Anerkennung der gleichen Rechte und Bedürfnisse anderer basiert und in einer pluralistischen Gesellschaft notwendig ist.
- Resonante Freiheit: Eine Form von Freiheit, die nicht in Isolation, sondern in Verbindung mit anderen und durch Einbettung in sinnstiftende Kontexte und Gemeinschaften lebendig wird.
- Gelingendes Leben: Ein Leben, das als erfüllend und sinnhaft empfunden wird, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Worin unterscheidet sich die im Text hauptsächlich behandelte Freiheit von der „negativen Freiheit“?
- Welchen Zusammenhang behauptet der Text zwischen politischer Freiheit und wirtschaftlicher Betätigung in einer kapitalistischen Gesellschaft?
- Was sind Beispiele für Begrenzungen und Regulierungen der wirtschaftlichen Freiheit im Modell der Sozialen Marktwirtschaft?
- Wie unterscheidet sich die Sichtweise auf Freiheit zwischen einer konservativ-liberalen und einer linken politischen Perspektive laut Text?
- Warum wurde „Freiheit“ während der Corona-Pandemie laut dem Text zu einem gesellschaftlichen Brennpunkt?
- Welche negativen Kehrseiten der maximalen individuellen Freiheit nennt der Text?
- Wie beschreibt der Text die vermeintliche Freiheit in der digitalen Sphäre?
- Welche Vorteile hat laut Text ein Mensch mit privilegierten Ressourcen bei der Nutzung individueller Freiheitsoptionen?
- Warum ist es laut dem Text in einer zivilisierten Gesellschaft notwendig, die Durchsetzung persönlicher Interessen zu begrenzen?
- Was meint der Text mit „resonanter Freiheit“?
Kommentare zu dieser Seite
(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).






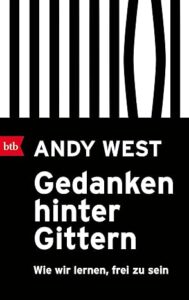
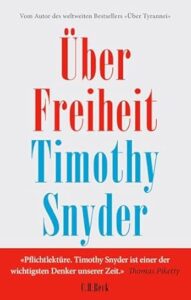
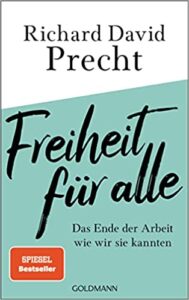
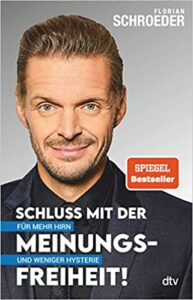
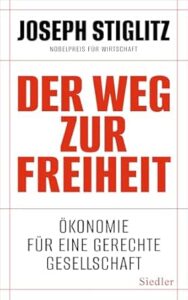

Schreibe einen Kommentar