Der Rote Faden
Wie wir die nächste Generation auf ihr Leben vorbereitet hat nicht nur Bedeutung für die betroffenen jungen Menschen, sondern bildet eine wesentliche Grundlage für die zukünftige WELTGESTALTUNG – zumindest in unserer Gesellschaft.
Dieses Thema steht daher am Ende der Ausführungen dieses Bereichs und bildet so etwas wie ein Übergang zu den Schlussbetrachtungen.
Aber auch die Erkenntnisse der WELTERKLÄRUNG spielt für Erziehung und Bildung eine wichtige Rolle: So sollte die Vermittlung eines rationalen Weltbildes ein inhaltliches Ziel darstellen; es sollte aber auch das Wissen über optimale Lernprozesse und über das Werden von reifen, gemeinschaftsfähigen und psychisch stabilen Persönlichkeiten einfließen.
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Vorlesen lassen
Schauern wir uns die im Test abgefragten potentiellen Bildungsinhalte einmal genauer an:
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Wissen

Bleiben wir zunächst beim einfachsten Thema, dem Faktenwissen.
Kaum jemand hält es heute noch für vordringlich, große Informationsmengen (z.B. Jahreszahlen oder Wahlergebnisse) im eigenen Gehirn abzuspeichern – wenn doch solcher Art Wissen jederzeit in Sekundenschnelle verfügbar ist.
Allerdings stellt sich die Frage, ob es nicht auch einer gewissen Faktengrundlage bedarf, wenn man z.B. in einem Gespräch auf Argumente reagiert oder spontan eigene Gedanken entwickelt. Wissen hilft eben auch beim Denken und stellt – in Form eines grundlegenden Allgemeinwissens – die Basis eines Weltverständnisses dar.
Man könnte auch zugespitzt sagen: Ohne ein sicheres Basiswissen hätte man kaum eine Chance zu erkennen, was man eigentlich wissen möchte und müsste.
Trennt man sich von dem reinen Faktenbezug, wird die oft propagierte Abkehr von der Wissensvermittlung noch problematischer: Man denke an ein Regelwissen, ein Prozesswissen oder ein Anwendungswissen. Auch hier verbergen sich natürlich Inhalte, die man nachschlagen könnte – aber für die geistige Durchdringung von Themen aller Art wäre es von großem Vorteil, wenn solche Wissensinhalte intern abrufbar wären.
Das alles spricht allerdings keineswegs gegen eine radikale Entschlackung von Stoffplänen – insbesondere in Bereichen, deren Verbindung mit einer Normalbiografie nicht nachvollziehbar ist (wie z.B. Teile der Oberstufen-Mathematik).
Urteilsvermögen

Die Fähigkeit, aus Informationen und Wissen sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen, ist wohl am engsten mit dem Faktenwissen verbunden.
Hier spielen komplexere kognitive Prozesse eine Rolle: Es geht um das Erkennen von Zusammenhängen, um logische Urteile, um kritisches Hinterfragen, um eine Sensibilität für (systematische) Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler usw.
Eine große Rolle spielt dabei ein eine solide Kompetenz beim Umgang mit Sprache, die – insbesondere in ihren abstrakten und logischen Anteilen – als Grundlage für unsere Denkprozesse und unsere Schlussfolgerunen dient.
Kritisches Denken und Urteilen lässt sich wohl nur sehr viel schwerer an eine App oder eine Software delegieren; wie weit die KI in diesem Bereich kommt, bleibt abzuwarten.
Technik

Große Einigkeit besteht in der Regel zwischen Fachleuten und der Öffentlichkeit hinsichtlich der Bedeutung von technologischen Kompetenzen als Grundlage für ein Leben im 21. Jahrhundert. Heute wird diese Diskussion immer stärker auf „digitale“ Kompetenzen reduziert.
Hatte man am Anfang dieses Jahrhunderts noch geglaubt, dass der souveräne Umgang mit Office-Anwendungen und die Beherrschung von ein paar Programmiersprachen die sicherste Grundlage für eine erfolgreiche Karriere darstellen könnte, findet seit ca. 2022 eine beispiellose Beschleunigung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) statt. Inzwischen ist es ohne Zweifel ein Full-Time-Job, überhaupt nur nachzuhalten, welche Weiterentwicklungen und Innovationen im Wochenrhythmus (manchmal vergehen auch nur Tage) angekündigt bzw. umgesetzt werden. Tausende von Experten sind weltweit permanent damit beschäftigt, die verschiedenen KI-Systeme der (meist) große Player in aufwendigen Benchmark-Tests miteinander zu vergleichen. Eine parallele Entwicklung findet im Bereich der Robotik statt.
Wie soll oder kann Erziehung und Bildung auf so etwas vorbereiten? Kein Mensch kann heute seriös abschätzen, wie der Arbeitsalltag in einem beliebigen Kopfarbeits- bzw. Bürojob in 5, 10 oder gar 20 Jahren aussehen könnte (s. dazu auch das Kap. „Wirtschaft“ und den Bereich „Ausblick und Zukunft„).
Aufgrund der immer anwendungsfreundlicheren Ausgestaltung von technischen Systemen (z.B. durch vollständige Sprachsteuerung) ist davon auszugehen, dass für die Anwendung von Digitaltechnik und KI in Zukunft eher deutlich weniger Fachkompetenzen benötigt wird. Im unteren und mittleren Qualifikationsbereich werden sich Kompetenzunterschiede vermutlich rasch nivellieren – während eine immer stärker spezialisierte Gruppe von genialen Visionären und hochbegabten Entwicklern die Spirale weiter vorantreiben werden (bis auch das endgültig in die Hände der selbst lernenden KI gelegt wird).
Kreativität
Die extrem schnell wachsenden digitalen Möglichkeiten bauen in atemberaubenden Tempo die Schwellen ab, die Mensch in früheren Zeiten von Quellen des Wissens ferngehalten haben. Damit scheinen sich auch die Unterschiede zu nivellieren, die bisher zwischen den Mitgliedern verschiedener Bildungsschichten bestanden. Informationen und Wissen sind inzwischen weder von der Art der Schulbildung, noch von materiellen Ressourcen abhängig (Internetzugang und Endgerät vorausgesetzt).
Werden also alle in Zukunft die gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten haben?

Wie wir gerade schon diskutiert haben, ist Wissen nicht mir Urteilsfähigkeit und Bewertung identisch. Aber es kommt noch ein wesentlicher Faktor hinzu: Die – typisch menschliche – Gabe der Kreativität entscheidet letztlich darüber, ob und wozu ich Informationen und Wissen nutze! Welchen Vorteil bringt mir der unbegrenzte Wissenszugriff, wenn ich weder Fragen noch Ideen in mir spüre?
Es könnte durchaus sein, dass sich die Unterschiede zwischen den Leistungen mehr oder weniger kreativer Personen in Zukunft sogar noch stärker ausdifferenzieren, weil das schöpferische Potential sich mit Hilfe der KI geradezu potenziert.
Um so bedeutsamer wird es also sein, in offenen und interdisziplinären Lernräumen Möglichkeiten der Kreativitätsförderung weiterzuentwickeln – statt weiter auf reinen Wissenserwerb zu setzen. Das ist auch deshalb wichtig, weil kreatives Tun eng mit Motivation, Selbstwirksamkeitserfahrungen und dem Erleben von Sinnhaftigkeit verbunden ist.
Alltag
Ab jetzt lösen wir uns allmählich von den Themen, die klassischer Weise Teil eines Bildungskanons waren und begeben uns in die pralle und komplexe Lebenswelt des 21. Jahrhunderts.
In einer Zeit der KI-dominierten Berufswelt könnte vielleicht zukünftig die eigentliche Herausforderung für die jungen Leute in der Bewältigung ihres persönlichen, praktischen und finanziellen Alltag liegen. Wie schlage ich eine Schneise durch die unendlichen Möglichkeiten einer Lebens-, Wohn-, und Freiheitgestaltung – mit all ihren Fallen und Tücken? Welches Grundwissen und welche Grundfertigkeiten benötige ich, um in dieser Vielfalt und Unübersichtlichkeit nicht zu stranden?
Oder werden diese Befürchtungen bald gegenstandslos, weil auch hier die digitalen Helferlein in Form von superschlauen Assistenten für alles und jedes zuständig sein werden?
Insbesondere für junge Menschen mit unzureichender familiärer Förderung wäre es – bis auf Weiteres – dringend zu wünschen, dass ihnen (vielleicht alternativ zum Interpretationtraining für klassische Lyrik) Rüstzeug für die Alltagsbewältigung vermittelt wird.
Selbstmanagement
Der Begriff hört sich nach „Selbstoptimierung“ an – man sieht schon die Smart-Watch am Handgelenk. Hier ist mit Selbstmanagement (Selbststeuerung, Selbstkontrolle) aber etwas anderes gemeint: Es geht um kognitive, psychische und emotionale Autonomie, die auf dem Verständnis für und den Einfluss auf eigenes Erleben, Denk- bzw. Urteilsprozesse und Verhalten basieren.
Erziehung und Bildung in diesem Sinne würde bedeuten, dass man sich selbst als fühlendes und denkendes System zu verstehen lernt und so die Möglichkeiten von Selbstreflexion, Eigensteuerung und Lebenszufriedenheit erweitert.
Konkrete Lehr-/Lerninhalte könnten sein:
– Umgang mit eigenen Emotionen und Impulsen (erkennen, verbalisieren, kontrollieren)
– Einflussnahme auf Stress- und Erregungsprozesse (Auslöser erkennen, Entspannungstechniken anwenden, Achtsamkeit)
– Bewältigung von Rückschlägen und Krisen (Förderung von Bewältigungsstrategien und Resilienz)
– Förderung von Genussfähigkeit und Selbstfürsorge
– Vermittlung von Skills rund um Motivation, Lernen und Arbeitsverhalten
Sozialkompetenz
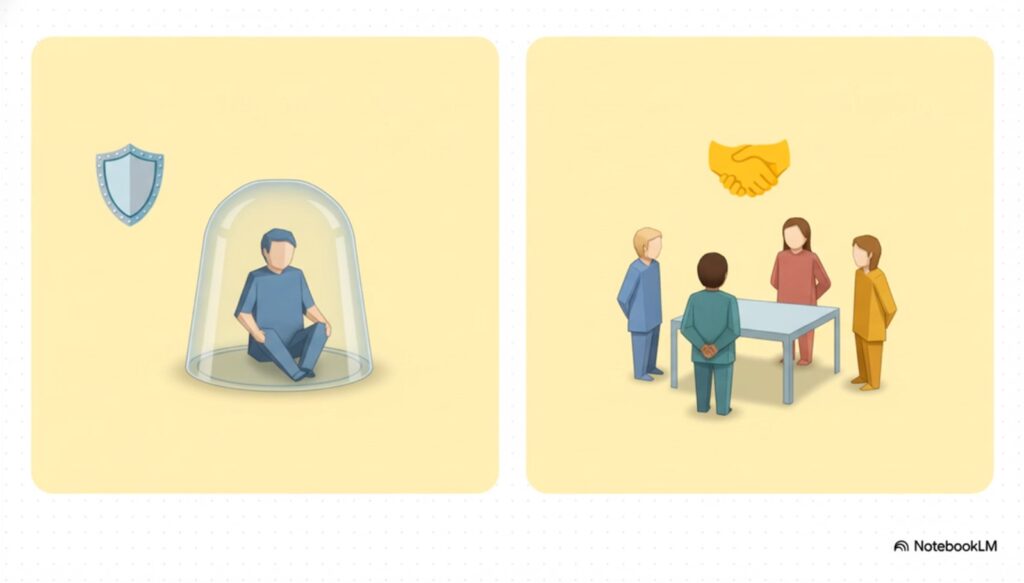
Die persönliche Seite des gerade skizzierten „Lebens-Trainings“ müsste natürlich noch um den sozialen, mitmenschlichen Bereich ergänzt werden:
Hier ginge es dann um Kommunikation, Kooperation, Teamfähigkeit, Empathie, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit (aktiv und passiv), Widerstand gegen Gruppendruck, Beziehungs- und Bindungsfähigkeit, aggressionsfreie Durchsetzungsfähigkeit, usw.
Gerade in einer Welt, in der schon die Kindheit immer stärker durch digitale Technologien geprägt wird, muss die umfassende Förderung sozialer Kontakte und Fähigkeiten ein zentrales Ziel sein. Es darf nicht länger dem Zufall überlassen bleiben, ob Kinder in ihrer Sozialisation die Chance bekommen, sich zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln.
Werte
Doch was ist mit der Werte-Erziehung, mit der Vermittlung von Ethik und Moral als Bildungsinhalt und -ziel? Verbleibt in einer pluralistischen Gesellschaft die Verantwortung dafür in den Familien (und vielleicht den religiösen Gemeinschaften)? Sollte oder müsste der Staat sich da ganz raushalten?
Hier tut sich eine Verbindung zu unseren Überlegungen im Kontext von Menschenbildern, Humanwissenschaften und gesellschaftlichen Regeln auf: Wenn wir den Menschen als ein Wesen betrachten, das nicht nur in seinem Verhalten, sondern auch in seinem Fühlen, Denken und Bewerten erst durch seine Umgebung und Erfahrungen zu einem Individuum wird und werden kann, dann ist eine ethische Neutralität keine ernsthafte Option.
Angesichts der riesigen Herausforderung, die in diesem Jahrhundert in den Bereichen Ökologie/Klima/Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit, Friedenssicherung und technologische Revolutionen (KI und Biotech) zu bewältigen sind, setzt das Überleben der Menschheit bestimmte Werte und Haltungen voraus. Eine solche Gemeinschafts- und Überlebensorientierung muss eine Gesellschaft entweder durch systematische und zielgerichtet Gestaltung der Lern- und Bildungsprozesse erzeugen – oder letztlich durch autokratische oder gar diktatorische Maßnahmen ersetzen.
Zwar schreiben sich auch aktuell unsere Bildungsinstitutionen und -pläne die Erziehung zu Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz und die Achtung von Menschenrechten und-würde auf die Fahnen, halten sich bei der praktischen Umsetzung aber stark zurück. Gleichzeitig wird ein riesiger Raum für Inhalte eröffnet, die der Interessensvertretung einzelner Gruppierungen bzw. wirtschaftlichen Zielen dienen.
Resümee

Wie kann es sein, dass wir so viel über die Entwicklung von Persönlichkeiten – von Fähigkeiten, Haltungen, Werten und Eigenschaften – wissen und uns doch als Gesellschaft in einem erschreckenden Ausmaß aus diesem Prozess heraushalten. Wieso steht die Vermittlung von Wissen und kognitiven Skills so sehr im Vordergrund, wenn doch Forschung und Erfahrung immer deutlicher zeigt, dass sowohl das Gelingen von individuellem als auch von gesellschaftlichem Leben vorrangig von der Persönlichkeitsentwicklung und der Gemeinschaftsfähigkeit abhängt?
Warum lassen wir – um es mal zuzuspitzen – so weitgehend zu, dass Zufälle und wirtschaftliche Interessen darüber bestimmen, welche Inhalte in die Gehirne der nachfolgenden Genration einsickern?
Es gibt wohl zwei Hauptgründe:
– Einmal spielt die Erzählung von dem wahren, autonomen „Selbst“ (oder „ICH“) eine Rolle, dem man durch geeignete Bedingungen einen Wachstumsraum bewahren müsse. Zuviel Einflussnahme auf Charakterbildung oder Wertesysteme wäre dann etwas Manipulatives, der Versuch den echten Kern der Persönlichkeit zu verformen oder gar zu brechen. Die Erkenntnis, dass es so einen wahren, unverfälschten Kern des ICHs ganz prinzipiell gar nicht geben kann, wird einfach nicht zur Kenntnis genommen (s. hierzu das Kap „Ichwerdung„).
– Das zweite Tabu betrifft die Idee des Pluralismus: Aus – historisch nachvollziehbarer – Sorge davor, Gesellschaften könnten ihre Macht dazu missbrauchen, ihre Bürger im Rahmen einer lebenslangen Indoktrination ideologisch gleichzuschalten, wird auf ein Nebeneinander von Werten und Weltanschauungen gesetzt. Vertreten und verteidigt werden nur bestimmte elementare Grundregeln; gleichzeitig wird ein unüberschaubares Nebeneinander von Lebenskonzepten in kauf genommen, obwohl dies den größten Teil der Bevölkerung chronisch überfordert.
Gibt es eine Lösung?
Mir scheint es zumindest sinnvoll und notwendig zu sein, sowohl das „Leben-Lernen“ stärker in den Fokus von Erziehung und Bildung zu setzen, als auch den Bereich der gesellschaftlich aktiv vertretenen und geschützten Grundwerte deutlich zu vergrößern: Ökologische Ignoranz und das Leugnen einer globalen und über die eigene Generation reichende Verantwortlichkeit für menschenwürdige Lebensbedingungen dürfen nicht länger als eine von vielen akzeptablen Haltungen behandelt werden.
Sie müssen im Mittelpunkt der Anstrengungen im Bereich „Erziehung/Bildung“ stehen.

Vorläufer-Themen
Wie entsteht aus den biologischen Vorgaben und den unzähligen inneren und äußeren Einflussfaktoren eine individuelle Persönlichkeit?
Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?
Parallel-Themen
Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?
Sollten sich Staat und Gesellschaft wirklich bzgl. Weltanschauungen und Wertesysteme neutral verwalten? Sollte es ein „freies Spiel der Kräfte“ geben – jede/r sucht sich etwas aus?
Nachfolge-Themen
Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
Kritische Analyse des deutschen Schulsystems
„Was kann und muss Schule leisten – und wer kann noch helfen, die Bildungskrise zu überwinden. Gibt es Patentrezepte? Welche Bildung genau brauchen wir eigentlich – jetzt und in den kommenden Jahrzehnten?“ Interessante Doku.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- Welterklärung: Der Prozess oder Bereich des Verstehens und Erklärens der Welt und ihrer Phänomene, oft im naturwissenschaftlichen Kontext.
- Weltgestaltung: Der Prozess oder Bereich des bewussten Beeinflussens und Gestaltens der Welt, oft im gesellschaftlichen, politischen oder ethischen Kontext.
- Bildungskanon: Die Gesamtheit der als wesentlich erachteten Inhalte und Kenntnisse, die im Rahmen der Bildung vermittelt werden sollen.
- Urteilsvermögen: Die Fähigkeit, aus Informationen und Wissen sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen und Sachverhalte kritisch zu bewerten.
- Digitale Kompetenzen: Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit digitalen Technologien, Anwendungen und Medien.
- Robotik: Das Gebiet, das sich mit der Entwicklung, Konstruktion, dem Betrieb und der Anwendung von Robotern beschäftigt.
- Kreativität: Die Fähigkeit, neue und originelle Ideen, Konzepte oder Lösungen zu entwickeln.
- Selbstmanagement (Selbststeuerung, Selbstkontrolle): Die Fähigkeit einer Person, ihr eigenes Erleben, Denken, Urteilen und Verhalten bewusst zu verstehen und zu beeinflussen.
- Sozialkompetenz: Die Fähigkeit, erfolgreich mit anderen Menschen zu interagieren, Beziehungen aufzubauen und sich in sozialen Situationen angemessen zu verhalten.
- Werte-Erziehung: Die Vermittlung von ethischen und moralischen Prinzipien und Haltungen im Rahmen der Bildung.
- Pluralismus: Die Koexistenz und Anerkennung einer Vielfalt von Meinungen, Werten, Lebenskonzepten und Weltanschauungen innerhalb einer Gesellschaft.
- Ichwerdung: Der Prozess der Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit aus biologischen Vorgaben und äußeren Einflüssen.
- Individualismus: Die Bedeutung des individuellen Seins und Wohlergehens im Vergleich zu den Interessen der Gemeinschaft.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Welche zentrale Bedeutung für die zukünftige Weltgestaltung wird der Vorbereitung der nächsten Generation auf ihr Leben im Text zugeschrieben?
- Warum wird die bloße Abspeicherung großer Informationsmengen im Gehirn heute als weniger vordringlich angesehen als früher?
- Welche Funktion hat laut Text ein grundlegendes Allgemeinwissen im Zusammenhang mit Weltverständnis und Denken?
- Welche Art von Wissen wird neben dem Faktenwissen im Text erwähnt, dessen interne Abrufbarkeit für die geistige Durchdringung von Themen von Vorteil wäre?
- Was versteht der Text unter Urteilsvermögen und welche kognitiven Prozesse spielen dabei eine Rolle?
- Warum wird die Förderung der Kreativität in Zukunft voraussichtlich noch bedeutsamer werden?
- Welche Art von Kompetenzen könnte für junge Menschen in einer KI-dominierten Berufswelt laut Text zukünftig eine besondere Herausforderung darstellen?
- Was ist im Text mit Selbstmanagement (Selbststeuerung, Selbstkontrolle) gemeint, und worauf basiert diese Autonomie?
- Warum sollte die umfassende Förderung sozialer Kontakte und Fähigkeiten gerade in einer durch digitale Technologien geprägten Kindheit ein zentrales Ziel sein?
- Welche Haltungen und Werte werden laut Text angesichts der globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts als notwendig für das Überleben der Menschheit betrachtet?
Kommentare zu dieser Seite
(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).





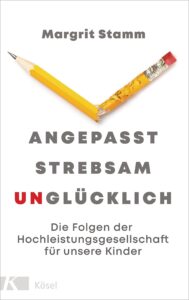
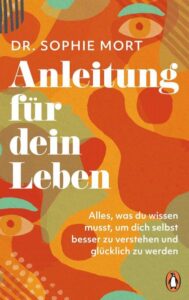
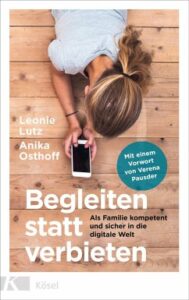
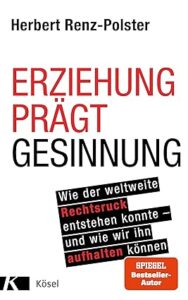
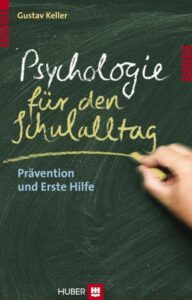
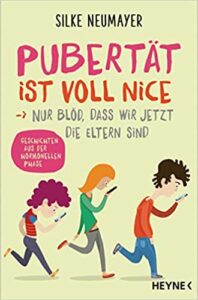
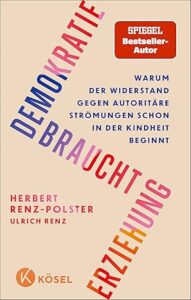

Schreibe einen Kommentar