Der Rote Faden
Pluralismus, also die gleichberechtigte Vielfalt der Interessen, Werthaltungen und Lebenskonzepte, gehört zu den zentralen Elementen der WELTGESTALTUNG in liberalen Demokratien. Der Begriff ist eindeutig positiv besetzt und hat starke Bezüge zu anderen hier diskutierten Aspekten der Ausgestaltung unserer Gesellschaft: Freiheit, Individualismus, Regierungsform.
Es könnte daher einige überraschen, dass hier – im Lichte der Erkenntnisse aus dem Bereich WELTERKLÄRUNG – auch kritische Überlegungen zur Rolle des Pluralismus angestellt werden. So könnten die Auseinandersetzung mit den Entstehungsbedingungen für bestimmte Wertesysteme (s. die Kap. Ichwerdung oder Lebenslenkung, aber auch Menschenbilder und Moral) deren Konsequenzen für die Zukunft auf diesem Planeten Zweifel daran entstehen lassen, ob neutrale Toleranz wirklich so erstrebenswert ist.
In diesem Beitrag geht es vorrangig um Werthaltungen, weniger um die Vielfalt von Interessen.
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Vorlesen lassen
In unserem Eingangstest sind wir das Thema Pluralismus aus einer bestimmten Perspektive angegangen: Sollte – und wenn ja – wie sollte die Gesellschaft dafür sorgen, dass bestimmte Wertvorstellungen als gemeinsame Basis eines Zusammenlebens dienen können. wir haben also gewissermaßen nach den notwendigen Grenzen einer Neutralität Ausschau gehalten.
Gehen wir die Varianten einmal durch:
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Vorgaben
Totalitäre oder diktatorische Systeme haben kein Problem damit, ihrer Bevölkerung eindeutige Werte und Weltbilder vorzugeben bzw. vorzuschreiben. Das gilt für fundamentalistische ideologische Regime genauso wie für religiöse Gottesstaaten.
Eine gemeinsame und verbindliche Wertordnung hat ohne Zweifel eine Reihe von Vorteilen: Die lästigen Konflikte um die richtige Weltsicht entfallen, die geteilten Überzeugungen über „richtig“ und „falsch“, über „moralisch“ und „sündhaft“ schaffen Gemeinschaft und Zugehörigkeit, der soziale Druck und die staatlichen Sanktionen sorgen für die Einhaltung der Regeln. Unter solchen Verhältnissen erscheint es auch recht einfach zu sein, nachwachsende Generationen in die unhinterfragte Weltsicht hineinwachsen zu lassen.
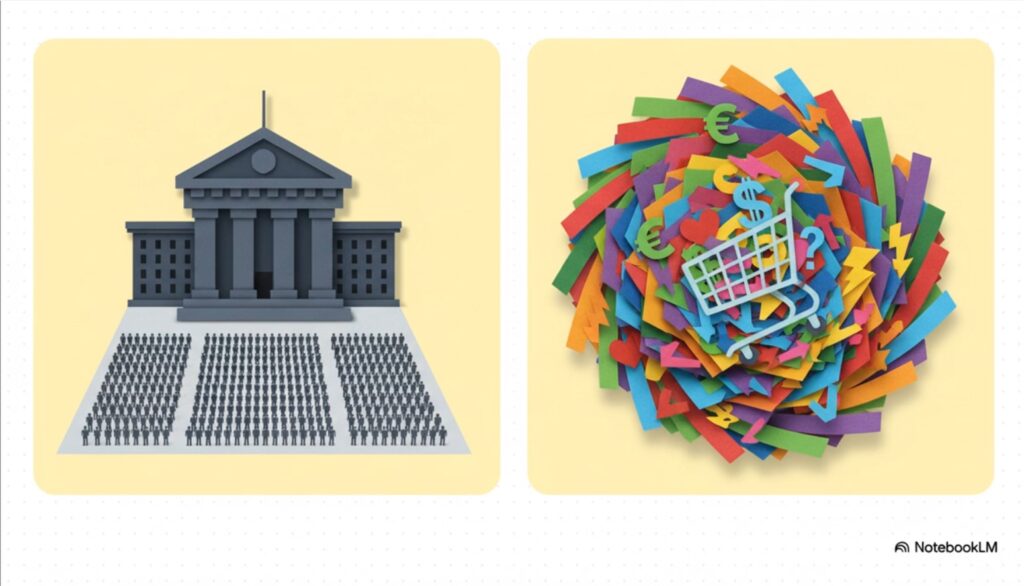
Nachteile und Risiken einer erzwungenen Gleichschaltung liegen allerdings auch klar auf der Hand: So ein System ist permanent bedroht von äußeren Einflüssen oder inneren Entwicklungen, die an der Alleingültigkeit und dem Ewigkeitsanspruch des Wertesystems rütteln könnten. Je rigider so ein System die eine Weltsicht verteidigt, desto mehr Sicherungen und Kontrollen müssen zu seiner Verteidigung eingesetzt werden. – was wiederum die Reaktanz vergrößern könnte.
Wie insbesondere die Geschichte des letzten Jahrhunderts gezeigt hat: Schon bei der Einführung bzw. der Etablierung einer allein seligmachenden Werteordnung müssen oft schon Maßnahmen ergriffen werden, die selbst die positivsten Ziele ad absurdum führen können: Wenn der Weg ins (vermeintliche) Paradies über Leichenberge führt, muss wohl irgendwo ein Fehler im System stecken…
Selbst wenn man diese grundsätzlichen Überlegungen mal zur Seite schiebt: Ein für immer festgelegtes Wertesystem trägt das Risiko der Erstarrung in sich. Die Welt ist ein hochdynamisches (technologisches, kulturelles, klimatisches) System: Nur ein für Veränderungen offenes Weltbild kann dafür eine Passung liefern.
Beliebigkeit

Also sollte sich der Staat, die Gesellschaft, raushalten und die Werteorientierung der Menschen dem freien Spiel der Kräfte überlassen? Das erscheint zumindest die von vielen gezogene Konsequenz aus verhängnisvollen Versuchen der Volks-(Um)erziehung.
Nach dem Modell der weltanschaulichen Neutralität ist es in erster Linie dem sog. „mündigen Bürger“ überlassen, sich aus dem Angebot der Welt- und Moralsichten das überzeugendste auszuwählen. Dabei wird billigend in kauf genommen, ja sogar gefordert, dass die Familie als primäre Sozialisationsinstanz einen prägenden Einfluss übernimmt. Da der Pluralismus sich ja dadurch auszeichne, dass eine Art Wettbewerb zwischen einem ganzen Strauß von Alternativen stattfinde, sei die Chance groß, dass der/die Einzelne das für sich und seine Interessen stimmige Konzept kennenlernen und auswählen könne.
Eine Reihe von Bedenken gegen dieses „Werte-Picking“ liegen allerdings auf der Hand:
So stellt sich z.B. die Frage, ob die Chancen zum Anbieten bestimmter Lebens-Ideen wirklich gleich und gerecht verteilt sind. Im Zeitalter privater Medienkonzerne und globaler Social-Media-Plattformen entscheidet wirtschaftliche und mediale Macht in einem erheblichen Umfang darüber, welche Leitbilder vorgestellt und verbreitet werden. Hinter bestimmten propagierten Lebensmodellen stehen massive finanzielle Interessen, die mithilfe riesiger Werbebudgets an den Mann, die Frau und an die jungen Leute gebracht werden.
Einer Gesellschaft mit beliebig vielen Werte-Systemen wird es nur schwer gelingen, so etwas wie eine gemeinsame Identität zu entwickeln; sie zerfällt möglichweise in unverbundene „Parallelgesellschaften“. Zugehörigkeitsgefühle sind aber eine wichtige Voraussetzung dafür, gemeinsame Aufgaben und Ziele zu verfolgen und Solidarität aufzubringen.
Ein Überangebot an Wertorientierungen kann auch Gefühle von Überdruss oder Gleichgültigkeit hervorrufen: Was man an jeder Straßenecke in unüberschaubaren Varianten angeboten bekommt, kann ja nicht wirklich einen „Wert“ besitzen…
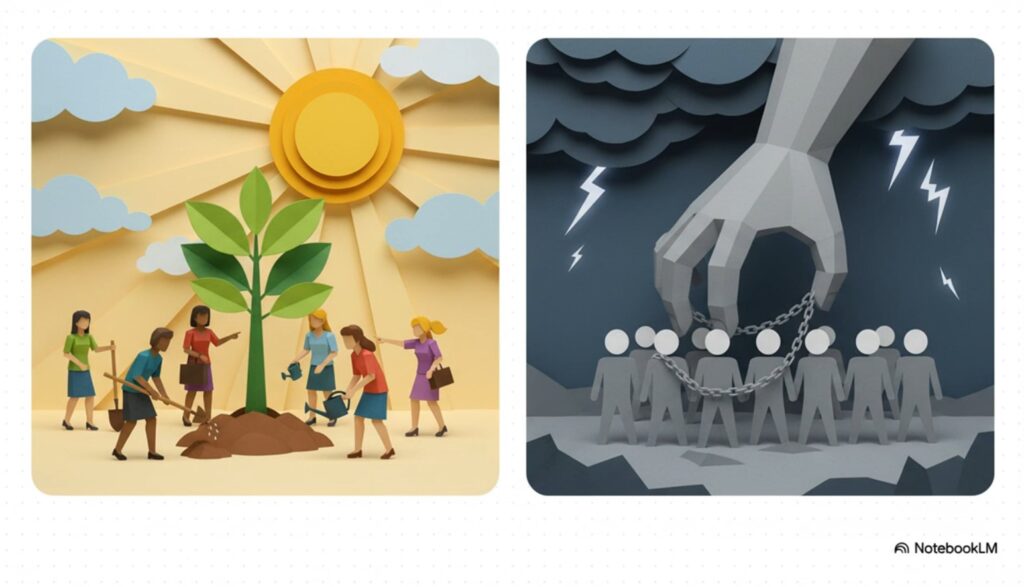
Darüber hinaus stellt sich angesichts der drängenden und extrem bedrohlichen Menschheitsprobleme (Klima, Umwelt, Ressourcen, Artensterben, Kriegsgefahr, Ungleichheit, neuer Imperialismus, Autokraten und Oligarchen, KI-Manipulation, …) sehr ernsthaft die Frage, ob es sich die Menschheit überhaupt (noch) eine Neutralität der persönlichen Prioritäten leisten kann. Können wir angesichts der bereits unübersehbaren Folgen der Erderwärmung ernsthaft die freie Wahl des Lebensstils als gesellschaftliche Errungenschaft anpreisen? Kann jeder nach seiner Façon selig werden, auch wenn der eine CO2-Fußabdruck zehnmal größer ist als der andere? Weil wir den Pluralismus verteidigen wollen?
Wohl kaum!
Grundwerte
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle ein wenig differenzieren: Tatsächlich sind sich ja die meisten Vertreter unserer Gesellschaftsordnung darüber einig, dass es keinen „absoluten“ Pluralismus geben sollte. Schließlich haben wir uns ja auf einen verfassungsmäßigen Rahmen verständigt: Diese Grundwerte stehen unter einem besonderen Schutz und daher nicht zur Disposition. Wir lassen also keine Weltanschauung zu, die Menschenrechte und Menschenwürde angreifen. Erst innerhalb dieses Rahmens gilt dann das Prinzip der weltanschaulichen Neutralität des Staates – also z.B. bzgl. der religiösen und politischen Orientierung bzw. der privaten Lebensführung.

Das klingt logisch und vernünftig – reicht aber nicht aus! Auch durch diesen – gemäßigten – Pluralismus wird weder der Einfluss wirtschaftlicher Interessen im Zaum gehalten, noch sichergestellt, dass der Schutz unserer Lebensgrundlagen nicht der Zufälligkeit von gerade im Trend liegenden Werteorientierungen ausgeliefert wird. Zu fordern wäre in diesem Zusammenhang, dass alle existentiell wichtigen Zukunftsthemen in den priorisierten Grundwerte-Bereich aufgenommen werden. Die Sicherung der Lebensoptionen zukünftiger Generationen darf nicht hinter dem Schutz des Eigentums und der persönlichen Freiheitsrechte zurückstehen.
Vermittlung
Wenn wir schon – über die Sicherung der Grundwerte hinaus – auf eine verbindliche Festschreibung einer gemeinsamen Weltanschauung verzichten wollen: Sollten wir dann nicht wenigstens dafür eintreten, dass nachhaltige, faire und gemeinwohlbezogene Haltungen als attraktiv und erstrebenswert gelten – oder auch als hipp und sexy?
Wenn doch sowieso klar ist, dass auch der moralische Teil unserer Persönlichkeit ein Produkt aller biografischen Einflüsse ist: Warum sollten wir dann als Gesellschaft hinnehmen, dass diese Einflüsse sich „zufällig“ ergeben oder die Folge systematischer Propaganda von Instanzen sind, die ihre ganz egoistischen wirtschaftlichen und machtmäßigen Interessen verfolgen?
In einem gewissen Umfang findet so etwas wie eine geplante „Wertevermittlung“ im Bildungssystem durchaus statt: Ziele wie „Toleranz“, „Demokratiefähigkeit“ und „Fairness“ finden sich in zahlreichen Bildungsplänen und fast in jedem Schul-Konzept. Die Frage ist allerdings, mit welcher Energie und in welcher Priorität solche Haltungen tatsächlich im schulischen Alltag gelebt und vermittelt werden (s. Kap. „Erziehung und Bildung„)
Und selbst, wenn das passieren sollte: Wie könnte diese zarte Pflanze gegen eine Medien- und Werbewelt bestehen, in der mit Milliardenaufwand ganz andere Botschaften in die noch jungen Gehirne geflutet werden?
Resümee
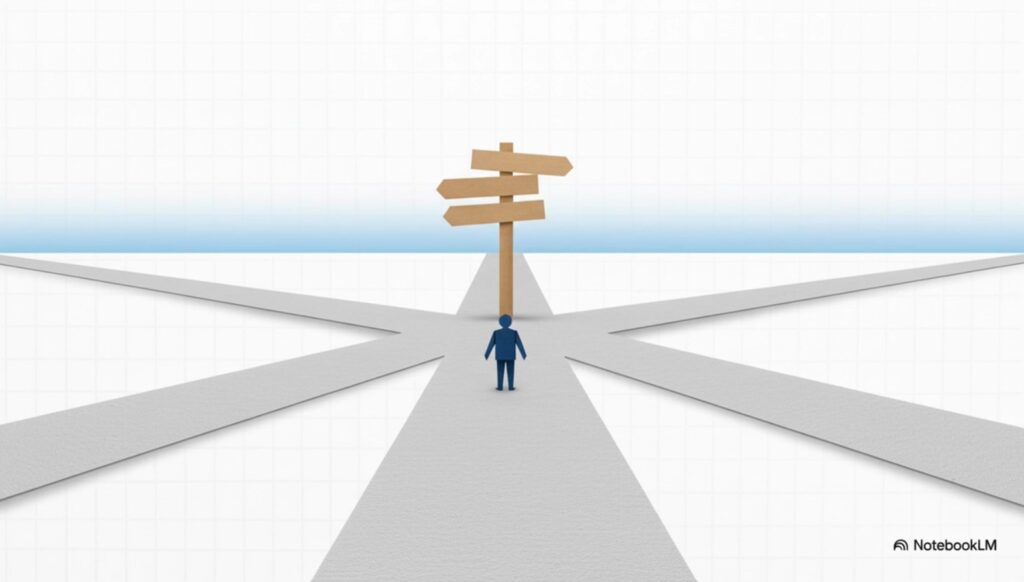
Das Prinzip des Pluralismus hat seine Stärken: Es bietet einen gewissen Schutz gegen den Machtmissbrauch durch mächtige Eliten, die ihren Wertekanon für eigene Interessen einsetzen wollen. Eine weltanschauliche Offenheit verhindert auch, dass Gesellschaften erstarren und sich nicht mehr den Veränderungen anpassen können.
Eine entscheidende Trumpfkarte ist die demokratische Legitimität: Wenn sich Mehrheiten aus dem Angebot der alternativen Leitideen bilden, verbieten sich Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit fast von alleine.
Allerdings haben die Humanwissenschaften das Bild vom autonomen Individuum, das sich selbst seine Identität und Werthaltungen aufbaut, gründlich in Frage gestellt. Trotzdem halten wir als Gesellschaft an dem Modell des Pluralismus fest, in dem der „mündige“ Bürger die (vermeintlich) freie – und möglichst kluge – Wahl zwischen Wertesystemen und Weltsichten haben sollte.
Angesichts des Tempos und der Dramatik, in der wir von globalen Herausforderungen bedroht sind, können wir uns dieses (sowieso unrealistische) „freie Spiel der Kräfte“ schlichtweg nicht mehr leisten. Erst recht nicht in einer Zeit der mächtigen digitalen Beeinflussungs-Algorithmen in privaten Händen.
Wenn wir als Gattung nicht scheitern wollen, bleiben uns letztlich nur zwei Alternativen: Entweder wir haben als Gesellschaft den Mut und die Entschlossenheit, die überlebenswichtigen Haltungen aktiver und nachdrücklicher zu vermitteln und zu stärken – oder uns bleibt vermutlich schon in naher Zukunft nichts mehr anderes übrig, als die Pluralität radikal abzuschaffen und die notwendigen Maßnahmen (auch undemokratisch) durchzusetzen. Die Öko-Diktatur lässt grüßen…

Zum Weiterdenken
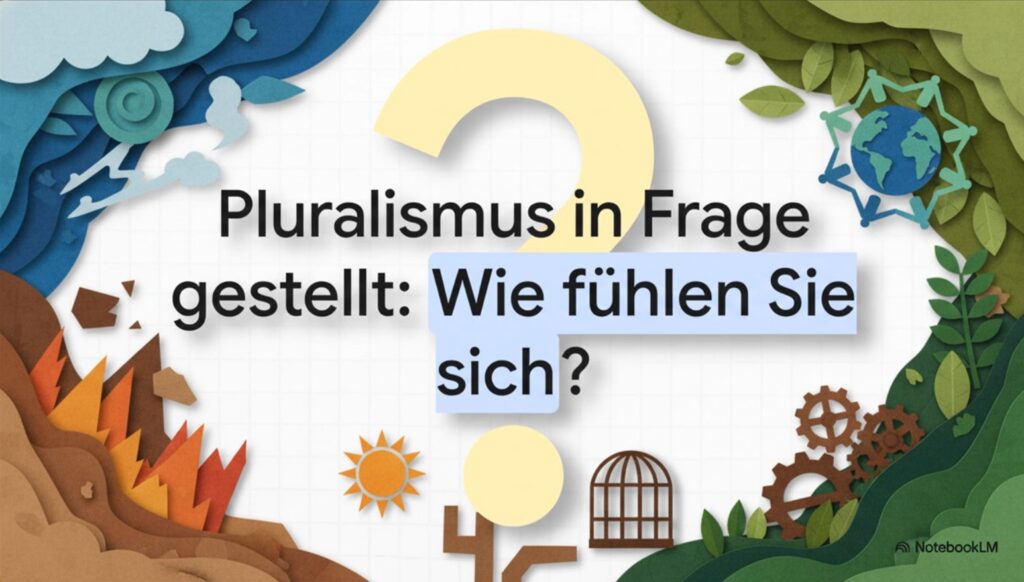
Wie geht es Ihnen damit, hier das so hochgeschätzte Prinzip des Pluralismus angekratzt zu sehen? Spüren Sie den Impuls, es zu verteidigen?
Oder haben Sie sich schon einmal über die „Gleichstellung“ von Werthaltungen geärgert, die Sie als völlig unakzeptabel oder sogar gefährlich angesehen haben? Z.B. in einer Talkshow?
Hatten Sie irgendwann in Ihrem Leben mal das Gefühl, eine Weltanschauung „gewählt“ zu haben? Oder haben sich Ihre Überzeugungen wie von selbst entwickelt?

Vorläufer-Themen
Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?
Wie entsteht aus den biologischen Vorgaben und den unzähligen inneren und äußeren Einflussfaktoren eine individuelle Persönlichkeit?
Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren für unseren Lebensweg? Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand? Besteht letztlich alles nur aus Zufällen?
Parallel-Themen
Welche Inhalte sollten der kommenden Generation vermittelt werden, damit sie den enormen Herausforderungen begegnen kann?
Wie kommt Moral in unsere Welt? Gibt es eine objektive und allgemeingültige Moral? Auf welche Prinzipien könnte man sich über alle Kulturen hinweg einigen?
Nachfolge-Themen
Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
Erklär-Video: Politischer Pluralismus
In einem typischen Lern- und Erklärvideo werden die Grundprinzipien des Pluralismus in der Demokratie erläutert.
Eine Art Wissens-Basis.
Pluralismus bei SCOBEL
Hier werden Vielfalt und Pluralismus leidenschaftlich verteidigt – ohne wenn und aber.
Das ist sicher sympathisch – und eine interessante Gegenposition zu der in diesem Projekt vertretenben Sichtweise.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- Pluralismus: Die gleichberechtigte Vielfalt von Werthaltungen und Lebenskonzepten, die als zentrales Element liberaler Demokratien betrachtet wird.
- Weltgestaltung: Der Prozess des bewussten Beeinflussens und Gestaltens der Welt, insbesondere im gesellschaftlichen, politischen oder ethischen Bereich, im Gegensatz zur Welterklärung.
- Welterklärung: Der Prozess oder Bereich des Verstehens und Erklärens der Welt und ihrer Phänomene, oft mit Bezug auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse.
- Werthaltungen: Individuelle oder kollektive Überzeugungen über das, was gut, richtig oder wichtig ist, und die das Verhalten und die Entscheidungen beeinflussen.
- Lebenskonzepte: Die Gesamtheit der Vorstellungen, Pläne und Ziele, die das Leben einer Person oder Gruppe prägen.
- Grundwerte: Fundamentale Prinzipien und Überzeugungen (wie Menschenrechte und Menschenwürde), die in einer Gesellschaft als besonders schützenswert gelten und den Rahmen für die Ausübung von Pluralismus bilden.
- Weltanschauliche Neutralität: Das Prinzip, dass der Staat sich in Bezug auf unterschiedliche Weltanschauungen (wie religiöse oder politische Überzeugungen) neutral verhalten sollte, insbesondere innerhalb des Rahmens der Grundwerte.
- Parallelgesellschaften: Gesellschaftliche Gruppen, die in erheblichem Maße isoliert voneinander leben und ihre eigenen Werte, Normen und Institutionen entwickeln, oft mit geringer Integration in die Gesamtgesellschaft.
- Wertevermittlung: Der Prozess der Weitergabe von Werten, Normen und Überzeugungen an nachwachsende Generationen oder andere Mitglieder der Gesellschaft, oft durch Bildungseinrichtungen oder andere soziale Instanzen.
- Gemeinwohlbezogen: Handlungen, Haltungen oder Ziele, die auf das Wohl der gesamten Gemeinschaft oder Gesellschaft ausgerichtet sind.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Was versteht der Text unter Pluralismus im Kontext liberaler Demokratien?
- Welche Vorteile werden einer gemeinsamen und verbindlichen Wertordnung in totalitären Systemen zugeschrieben?
- Was ist laut Text der primäre Nachteil einer erzwungenen Gleichschaltung von Werten?
- Nach dem Modell der weltanschaulichen Neutralität, wem wird in erster Linie die Auswahl von Welt- und Moralsichten überlassen?
- Welche Rolle spielen laut Text private Medienkonzerne und globale Social-Media-Plattformen bei der Verbreitung von Leitbildern?
- Welches Risiko birgt ein Überangebot an Wertorientierungen für die Gesellschaft?
- Welche Art von Weltanschauung wird laut Text im Rahmen der Grundwerte liberaler Demokratien nicht zugelassen?
- Warum reicht der Schutz der Grundwerte allein laut Text nicht aus, um die drängenden globalen Probleme anzugehen?
- Welche Haltungen sollten laut Text, auch wenn auf eine verbindliche Festschreibung verzichtet wird, als attraktiv und erstrebenswert vermittelt werden?
- Welche zwei Alternativen bleiben der Menschheit laut Text, wenn sie als Gattung nicht scheitern will?
Kommentare zu dieser Seite
(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).








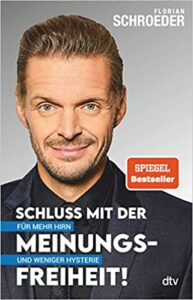
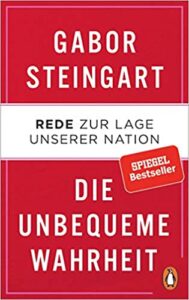
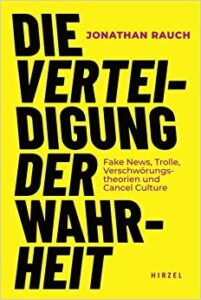
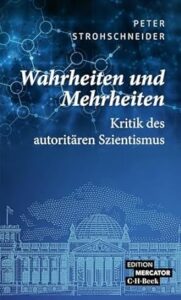
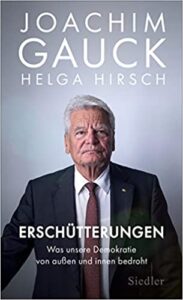
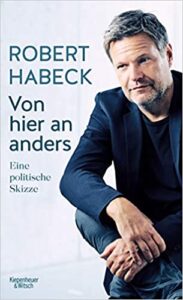
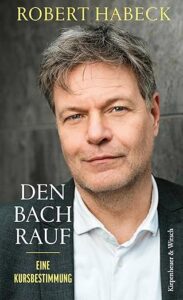

Schreibe einen Kommentar