Der Rote Faden
Kein vernünftiger Mensch würde im 21. Jahrhundert bezweifeln, dass die Bewältigung der drohenden Klimakatastrophe zu den vordringlichsten Aufgaben der WELTGESTALTUNG gehört.
Die Forschungs- und Erfahrungslage ist so klar, dass in diesem Projekt auf eine Darstellung der wissenschaftlichen Hintergründe des Klimawandels im Bereich WELTERKLÄRUNG ganz verzichtet wurde.
Worauf nicht verzichtet werden kann, ist eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen politischen Ansätzen für die Gestaltung einer wirksamen Klimapolitik.
Dabei entsteht eine inhaltliche Nähe so anderen Gestaltungsthemen wie Regierungsform, Pluralismus, Freiheit, Individualismus.
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Der kleine Selbsttest zur Klimapolitik hat mögliche gesellschaftliche Reaktionen auf die Klimakrise in die folgenden idealtypische 4 Optionen unterteilt:
Vorlesen lassen
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
1. Die Mehrheit entscheidet

Die Grundlage für eine repräsentativ-demokratische Gesellschaftsordnung bildet das Mehrheitsprinzip: Parteien werden in Parlamente gewählt, um die Politik umzusetzen, die sie den Wahlberechtigten als Programm angeboten haben. Je stärker sie Parlament vertreten sind, desto größer ist die Erwartung des Wahlvolkes, dass ihr übertragener Wählerwillen zur Anwendung kommt.
Anders als bei einer direkten Demokratie (mit häufigen Volksentscheiden) ist die Übersetzung von aktueller Wählermehrheit allerdings ein wenig kompliziert: Weder stimmt man mit jedem Teil des Wahlprogrammes einer Partei gleichermaßen überein (soweit überhaupt konkrete Aussagen vorliegen), noch können im Voraus alle Problemlagen bzw. Entscheidungsnotwendigkeiten berücksichtigt werden.
Entweder man überlässt das jeweils konkrete Handeln dann den Volksvertretern – so dass es also faktisch um die Parteien-Mehrheit im Parlament und nicht (mehr) bei den Wählern geht – oder man versucht durch häufige Meinungsumfragen die Stimmung im Volk zu erfassen und sieht dann die jeweilige Regierung in der Verantwortung, die Mehrheitsmeinung umzusetzen.
Eine weitere Komplikation besteht darin, dass oft Widersprüche zwischen Mehrheiten für grundsätzliche Ziele („wir wollen den Klimawandel bekämpfen“) und der Einschätzung einzelner Umsetzungsschritte bestehen („wir wollen selbst entscheiden, wie wir heizen“). Das Mehrheitsprinzip könnte dann im Extremfall bedeuten, dass jede einzelne Maßnahme auf ihre Zustimmungsfähigkeit überprüft werden müsste – so wie es Bundeskanzler Scholz tatsächlich einmal formulierte. Wäre dann Politik überhaupt noch handlungsfähig – angesichts der Tatsache, dass die Bewertung von Einzelfragen in der Bevölkerung sich aufgrund von aktuellen Ereignissen oder durch Beeinflussung durch interessierte Kreise rasch verändern können? Darf sich verantwortungsvolle Politik dem ausliefern?
Was deutlich wird: Selbst wenn man die Klimapolitik an der Mehrheit ausrichten möchte, ist die konkrete Umsetzung dieses Prinzips nicht ganz einfach…
2. Aufklären und Überzeugen

Nein, man kann und darf es nicht dem Zufall oder gar bestimmten wirtschaftlichen Interessen überlasen, welche Einstellungen die Bevölkerung gegenüber der existentiellen Klimafrage entwickelt. In allen Lebensbereichen und auf allen Kanälen müssten Informationen fließen, die natürlich auch in ihrer Bedeutung eingeordnet und bewertet werden müssen. Das gilt für die schulische Bildung, für die Medien, für politische Gruppierungen – selbst für Vereine und Kirchen.
Menschen, die einen Informationsvorsprung haben, müssten diesen nutzen, um ihre Familie, ihre Nachbarn und ihre Kollegen aufzuklären.
Aber reicht es, über die Entstehung und die möglichen Folgen des Klimanotstandes zu informieren? Ganz sicher nicht!
Widerstand gegen eine ambitionierte Klimapolitik entzündet sich nicht am Streit über die physikalischen bzw. chemischen Zusammenhänge und deren klimatischen Auswirkungen. Es geht letztlich um die Auswirkungen auf das Alltagsleben: auf Wohlstand, Lebensgewohnheiten, Bequemlichkeit und Gesundheit. Auf diesen Ebenen wägen Menschen – mehr emotional als rational – ab, ob sie eher die (mittelfristigen) Folgen des Klimawandels fürchten oder die (kurzfristigen) Folgen von politischen Gegenmaßnahmen.
Menschen brauchen also klare Konzepte davon, dass die (insgesamt überschaubaren) Kosten und Zumutungen einer echten Klimapolitik in keinem Verhältnis zu den Auswirkungen einer weitgehend ungebremsten Erderwärmung stehen. Mit diesem Wissen ausgestattet müssten Menschen eigentlich nicht besonders altruistisch sein; es genügte, die eigenen (ganz egoistischen) Interessen wirklich im Auge zu haben.
Allerdings gibt es (mindestens) zwei Haken an dieser Argumentation: Menschen sind zum einen evolutionär darauf gepolt, kurzfristige Folgen für bedeutsamer zu halten als langfristige Konsequenzen. Zum anderen – und jetzt wird es doch noch moralisch – beschränkt sich die Reichweite ihres moralischen Verantwortungsgefühls auf die nähere geografische und zeitliche Umgebung. Wir bräuchten aber eine Klimamoral, die den ganzen Globus und die nächsten Generationen mit umfasst.

Die sozial- und wirtschaftspsychologische Forschung hat noch eine ganze Menge andere Denk- und Bewertungsfallen aufgedeckt, die dazu führen, dass – eigentlich – logische Zusammenhänge nicht verstanden werden bzw. nicht zu den naheliegenden Schlussfolgerungen führen.
Auch diese sind dafür verantwortlich, dass Aufklärung und Informationen oft nicht zu den notwendigen Handlungen führen.
Der Mensch entscheidet nicht nur – viel häufiger als gedacht – eher emotional als rational; selbst das vermeintlich vernünftige Abwägen wird von jeder Menge Verzerrungen bei Wahrnehmung und Urteilsbildung unterlaufen.
Doch es geht nicht nur um die Psychologie der Menschen: Es werden von der entsprechenden Industrie weiterhin jedes Jahr Milliarden investiert, um mit Hilfe von Propaganda, Lobbyismus und Korruption das Geschäftsmodell der fossilen Energieträger so lange wie eben möglich auszudehnen. Hier walten schlichtweg massive Profitinteressen – konzentriert bei einigen der mächtigsten und finanzkräftigste Konzerne der Welt.
Wie lange wollen wir noch versuchen, mit gut gemeinter Aufklärung und Bildung dagegen zu halten?
Zentralbanken und große Versicherer warnen längst vor der Unberechenbarkeit der wirtschaftlichen Risiken von Klimafolgeschäden. Diese müssten dann letztlich von der Allgemeinheit getragen werden, während die astronomischen Gewinne in private Hände flossen und fließen.
3. Das einmal Beschlossene umsetzen

Der normale Alltagsmensch ist sicherlich damit überfordert, die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Entscheidung über politische Maßnahmen zu verfolgen. Im Regelfall wird er sich in einer parlamentarischen Demokratie darauf verlassen, über grundlegende Zielsetzungen im Rahmen des Wahlrechts mitzuentscheiden – und dann die Politiker (gestützt auf ihre Expertenstäbe) ihren Job machen zu lassen. So müsste es bei der Klimapolitik ausreichen, eindeutige inhaltliche und zeitliche Zielsetzungen festzulegen und sich dann auf die sachgerechte Umsetzung verlassen.
Genau das war der Ansatzpunkt der Klimabewegung Fridays for Future in den späten 2010er Jahren: Sie wollten von den Regierungen nicht mehr als die fristgerechte Umsetzung der eigenen verbindlichen Beschlüsse. Das führte zu so absurden Situationen, dass ein amtierender Wirtschaftsminister (Altmayer) sich öffentlich bei Klimaaktivisten für Druck in Richtung Einhaltung der beschlossenen Gesetze bedankte (sinngemäß: „Ohne Sie hätten wir viel weniger getan“).
Es müsste also bei den verantwortlichen Regierungsmitgliedern mehr Mut und mehr Geradlinigkeit bei der Umsetzung bereits beschlossener Entscheidungen geben – unabhängig davon ob die öffentliche Stimmungslage mal ins Schlingern kommt. Die Machtoptionen für ein solches Vorgehen wären zweifellos vorhanden. Was jedoch fehlt, ist die Festigkeit, sich auch einem medialen Gegenwind zu stellen und drohende Verluste in der Wählergunst kurzfristig in kauf zu nehmen.
Wer soviel Prinzipientreue in unserer hektischen, immer auf die nächste Landtags- oder Kommunalwahl ausgerichteten Politikwelt für unrealistisch hält, müsste sich für eine anderen Weg einsetzen: Wir haben uns auch bei anderen grundlegenden Fragen dazu entschlossen, sie aus dem hektischen Spiel der Stimmungen herauszuhalten. So wird z.B. die Geldpolitik von unabhängigen Institutionen gesteuert, die nicht von momentanen Mehrheiten abhängig sind. Sie sind klar definierten Zielen (Geldwertstabilität) verpflichtet und sind in der Lage, auch Entscheidungen zu fällen, die weder der amtierenden Regierung, noch der Wählermehrheit gefallen müssen.
Ein ähnliches Modell bietet sich für die Klimapolitik an: Die Stabilität des Weltklimas ist für unser zukünftiges Wohlbefinden sicher nicht weniger wichtig als die Inflationsrate. Wenn selbst das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (von 2021) zur Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen nicht ausreicht, müsste dringend ein entsprechender institutioneller Rahmen geschaffen werden.
4. Das Notwendige vorgeben und durchsetzen
Selbst viele Freunde der Demokratie schauen gelegentlich voller Neid in Richtung China: Zwar ist die Ein-Parteien-Diktatur sicher kein großer Umweltengel – aber es ist schon sehr beeindruckend, wenn man mitbekommt, wie schnell und konsequent einmal getroffene Entscheidungen durchgezogen und durchgehalten werden. All die lähmenden und umständlichen Diskussions-, Abstimmungs- und Umsetzungsprozesse entfallen schlichtweg; ebenso die diversen Gutachter-Schlachten und die juristischen Instanzen.
Auch wenn die Aktivisten üblicher Weise eher dem Demokratie-affinen linken Politik-Spektrum angehören: Für manche stellt sich angesichts der Dramatik und Unumkehrbarkeit der Entwicklung die ernsthafte Frage, ob nicht die Rettung unserer Lebensgrundlagen wichtiger ist als die Einhaltung demokratischer Spielregeln. Wenn sie nicht schon gleich selber die Öko-Diktatur einläuten wollen, weisen sie – mit guten Argumenten – darauf hin, dass letztlich die Sachzwänge autoritäre Eingriffe unvermeidbar werden lassen. Und zwar dann, wenn Dummheit, Trägheit oder Egoismus es verhindert haben, dass die Umsteuerung auf der Ebene des demokratischen Konsenses gelingt.

Resümee
Es gibt kaum einen anderen Politik-Bereich, in dem der Konflikt zwischen den Erkenntnissen der (Klima-)Wissenschaft und dem Anspruch auf „Entscheidung nach Mehrheiten“ so klar zu Tage tritt. Eine entscheidende Variable ist dabei der Zeitdruck: Jedes zusätzliche Jahr, das verloren wird, weil die notwendigen Mehrheiten (noch) nicht überzeugt sind, kostet mittel- und langfristig nicht nur (zusätzliche) Unsummen an Geld, sondern auch Lebensqualität, Leid und Menschenleben. Das alles ist schon heute kalkulierbar; alle Klimaprognosen der letzten Jahre waren tendenziell eher zu optimistisch.
Wenn ich entscheiden dürfte, würde ich zwar den 2. Weg (Aufklärung) weiterführen, würde mich aber bzgl. des politischen Handelns zwischen 3. (Umsetzen des Beschlossenen) und 4. (Notwendiges vorgeben und durchziehen) verorten.
Begründen bzw. rechtfertigen würde ich diesen Kurs mit der Logik, die diesem Projekt zugrunde liegt: WELTERKLÄREN sollte zu WELTGESTALTEN führen! Und manchmal muss die Wissenschaft nicht nur die Richtung, sondern auch das Tempo vorgeben. Dafür ist der Klimabereich ein Beispiel!

Die Chancen für Gesundheit, Lebensqualität und unsere Exportwirtschaft, die mit einem konsequenten Umsteuern auf eine klimafreundliche Lebens- und Wirtschaftsweise verbunden wären, sollen hier zumindest eine kurze Erwähnung finden.
Zum Weiterdenken
Wie oft erleben Sie persönlich die innere Zerrissenheit zwischen dem Wissen um die Dramatik des Klimawandels und der Trägheit von eigenen Gewohnheiten und Rechtfertigungen?
Kennen Sie Momente, in denen Ihnen dieses ganze Gerede von Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit richtig auf die Nerven geht?
Ärgern Sie sich eher über das Zaudern und Verzögern in der Politik, über die Macht der Konzerne oder verzweifeln sie am Egoismus bzw. der Dummheit der ganz normalen Menschen?
Erwischen Sie sich manchmal – ganz für sich alleine – dabei, dass Ihnen das ganze Thema (auch) deshalb nicht so wichtig ist, weil es Sie persönlich nicht mehr betreffen wird? Würden Sie das auch laut sagen? Auch Ihren Kindern? Wären Sie wirklich gerne so ein Mensch?

Vorläufer-Themen
Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?
Welche Bedeutung hat das individuelle Sein und wohlergehen im Vergleich mit den Interessen der Gemeinschaft?
Parallel-Themen
Welche Form der politischen Ordnung ist am ehesten in der Lage, die anstehenden Menschheitsprobleme zu lösen?
Nachfolge-Themen (Auswahl)
Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
Eine Klima-Vorlesung von Harald LESCH
LESCH gibt eine faktenreiche Zusammenfassung des aktuellen Zustandes (Anfang 2025).
arte-Report über die Rolle der Superreichen in der Klimakrise
Eine beeindruckende Zusammenstellung der (schwer zu ertragenden) Verantwortungslosigkeit einer globalen Wirtschafts- und Finanzelite.
Graeme MAXTON beim SRF
Der ehemalige Generalsekretär des „Club of Rome“ stellt klare und konsequente Forderungen an eine rasche Umsteuerung für unser Wirtschaften und unser Leben. Klartext!
Vortrag von Ralph FÜCKS
Die Frage wird gestellt, welche Lehren wir aus Jonas‘ „Prinzip Verantwortung“ für Klimakrise ziehen müssen.
Können die Mittel der Demokratie ihre größte Bewährungsprobe bestehen?
SCOBEL über Klimawandel-Leugnung
In seiner bekannten expressiven Art widerlegt SCOBEL die „Argumente“ von Personen und Gruppierungen, die den menschengemachten Klimawandel bestreiten.
Gespräch mit Jonas SCHAIBLE
Ein ausführliches Gespräch über das Buch „Demokratie im Feuer“.
Der Autor mahnt dringend zusätzliche Maßnahmen und politische Strukturen an und hat dabei sehr gute Ideen.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- Weltgestaltung: Der Prozess oder Bereich des bewussten Beeinflussens und Gestaltens der Welt, oft im gesellschaftlichen, politischen oder ethischen Kontext. Im Text spezifisch bezogen auf die politische Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.
- Welterklärung: Der Prozess oder Bereich des Verstehens und Erklärens der Welt und ihrer Phänomene, oft im naturwissenschaftlichen Kontext. Im Text steht dies im Gegensatz zur „Weltgestaltung“ und wird als bereits hinreichend klar bezüglich der wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels angesehen.
- Mehrheitsprinzip: Die Grundlage für eine repräsentativ-demokratische Gesellschaftsordnung, bei der Entscheidungen von der Mehrheit getroffen werden. Im Text wird seine Komplexität und Herausforderung für die Klimapolitik beleuchtet.
- Aufklären und Überzeugen: Eine politische Strategie, die darauf abzielt, die Bevölkerung durch Information und Argumentation von der Notwendigkeit und den Vorteilen einer bestimmten Politik zu überzeugen. Im Kontext der Klimapolitik wird die Frage aufgeworfen, ob dies allein ausreicht.
- Das einmal Beschlossene umsetzen: Ein politischer Ansatz, der sich auf die konsequente Implementierung bereits getroffener Entscheidungen konzentriert, unabhängig von kurzfristigen Stimmungsschwankungen. Fridays for Future wird als Beispiel für diesen Ansatz genannt.
- Das Notwendige vorgeben und durchsetzen: Eine politische Strategie, die sich an den Sachzwängen und der Dringlichkeit orientiert und notfalls auch autoritäre Eingriffe oder von der Mehrheitsmeinung abweichendes Handeln beinhaltet.
- Klimamoral: Ein erweitertes moralisches Verantwortungsgefühl, das den gesamten Globus und zukünftige Generationen in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels umfasst.
- Sachzwänge: Unabwendbare Notwendigkeiten oder Tatsachen, die bestimmte Handlungen oder Entscheidungen erforderlich machen. Im Text wird argumentiert, dass die Dramatik des Klimawandels Sachzwänge schaffen könnte.
- Autoritäre Eingriffe: Maßnahmen oder Entscheidungen, die von einer Autorität oder einer kleinen Gruppe getroffen und durchgesetzt werden, oft unter Umgehung demokratischer Prozesse.
- Umsteuern: Eine grundsätzliche Änderung der Richtung oder des Kurses, insbesondere im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich hin zu klimafreundlichen Praktiken.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Warum verzichtet der Text auf eine Darstellung der wissenschaftlichen Hintergründe des Klimawandels?
- Welche vier idealtypischen Optionen für gesellschaftliche Reaktionen auf die Klimakrise werden im Text unterschieden?
- Was ist eine Komplikation bei der Umsetzung des Mehrheitsprinzips in der Klimapolitik, die im Text genannt wird?
- Reicht laut Text die reine Information über die Entstehung und Folgen des Klimanotstands aus, um Widerstand gegen Klimapolitik zu überwinden?
- Welche Rolle spielen nach dem Text menschliche Emotionen und rationale Abwägungen bei der Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen?
- Was ist laut Text evolutionär bedingt bei der menschlichen Einschätzung von kurz- und langfristigen Folgen?
- Warum genügen Aufklärung und Information laut Text oft nicht, um zu notwendigen Handlungen zu führen?
- Was war der Ansatzpunkt der Klimabewegung Fridays for Future laut Text?
- Welches Modell aus einem anderen Politikbereich wird als mögliche Inspiration für die Klimapolitik vorgeschlagen?
- Warum blicken laut Text manche Freunde der Demokratie mit Neid in Richtung China bezüglich der Klimapolitik?
Kommentare zu dieser Seite
(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).






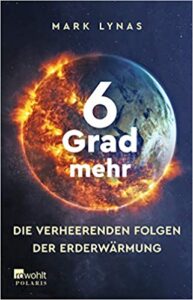
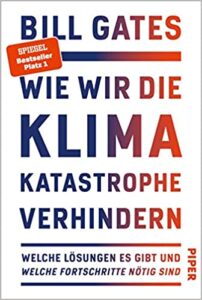
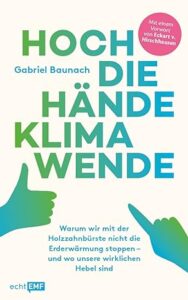
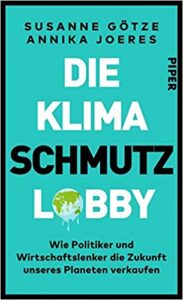
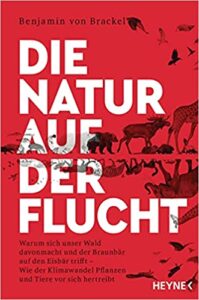
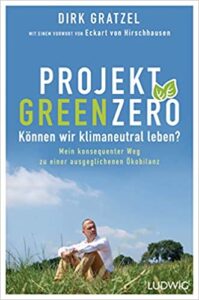
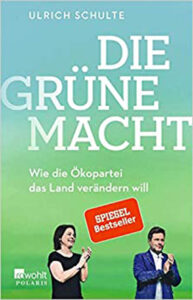
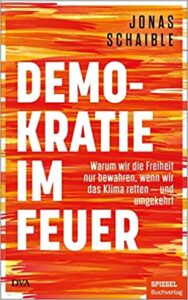
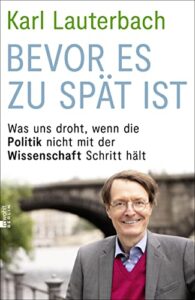
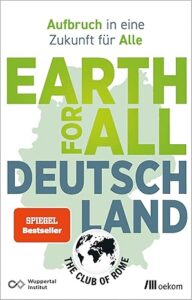
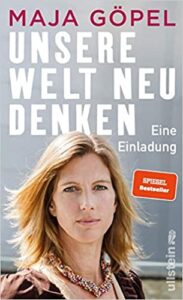
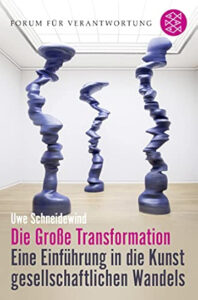
Schreibe einen Kommentar