Der Rote Faden
Nach dem wir uns bei der WELTERKLÄRUNG im Bereich der Weltbilder und der Menschenbilder mit der (fehlenden) Erklärungskraft der Glaubenssysteme befasst haben, werden hier Religionen als eine Form von persönlichen WELTZUGÄNGEN behandelt.
Es geht also darum, welche sozialen, emotionalen, spirituellen oder transzendenten Bedürfnisse durch Religionen erfüllt werden könnten – und welche Nebenwirkungen das haben könnte.
Der Gottesglaube steht damit hier in Konkurrenz mit anderen – weltlichen oder jenseitigen – potentiellen Sinnstiftungs-Quellen (die Links finden sich unten auf der Seite).
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Vorlesen lassen
Beginnen wir die Suche nach der Spiritualität mit dem wohl menschheitsgeschichtlich bedeutsamsten Ansatz, das menschliche Dasein in einen größeren Zusammenhang von Sinn, Bedeutung, Zielsetzung, Einbettung, Zugehörigkeit, Trost, Moral und Zuversicht zu stellen – den religiösen Glaubenssystemen. Etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung bezeichnet sich als gläubig; das sind annähernd sechs Milliarden Menschen.
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Können so viele Menschen irren?

Es geht an dieser Stelle nicht um Recht oder Irrtum. Die religiöse Variante von Spiritualität ist offenbar eine menschliche Grundtendenz, die sich in ganz verschiedenen Formen und Ausprägungen zeigt. Insbesondere die in großen kirchlichen Gemeinschaften organisierte Religiosität weist allerdings eine Besonderheit auf, die sie von allen anderen spirituellen Angeboten bzw. Wegen unterscheidet: In den allermeisten Fällen entscheiden die Mitglieder über ihre Zugehörigkeit nicht als erwachsene Personen aufgrund eines Abwägens oder eines Erweckungserlebnisses; sie werden (ungefragt) in die Glaubensgemeinschaft ihrer Eltern (oder sogar eines ganzen Landes) hineingeboren und hineinsozialisiert. Nicht die Entscheidung für die Religion, sondern die Entscheidung dagegen bedarf eines individuellen Aktivwerdens. Ein solcher Entschluss ist in modernen Gesellschaften nur ein kleiner Verwaltungsakt, in vielen anderen Kulturen mit Abwertung und Ausgrenzung verbunden; in manchen Gegenden der Welt kann dieser Schritt sogar lebensgefährlich sein.
Es ist also erstmal kein Wunder, dass die großen Religionen die Sinnstiftungs-Hitliste anführen.
Im Gegensatz zu anderen Sinn-Systemen, für die man sich aktiv entscheidet, ist bei der Selbsteinschätzung als „gläubig“ nicht so ganz klar, wie intensiv dieser Glaube das Leben des einzelnen Menschen tatsächlich bestimmt: Welche Rolle spielen das private Gebet, der gemeinsame Gottesdienst, das Gemeindeleben oder die kirchlichen Feiertage tatsächlich für die hier betrachteten Funktionen? Oder geht es um ein ganz diffuses Bedürfnis sich irgendwie „aufgehoben“ oder „getragen“ zu fühlen – angesichts der Bedrohungen der Welt und der unvermeidlichen Sterblichkeit? Oder sind es die offenen Fragen nach dem Anfang von allem („Irgendwas muss doch schließlich vor dem Urknall gewesen sein…“)?
Abschied von der Rationalität

Eins ist jedenfalls eindeutig: Mit der inneren Hinwendung an den religiösen Weltzuggang, mit dem Bezug auf ein göttliches Wesen ist die – sicher nicht immer ganz bewusste – Entscheidung verbunden, sich aus dem Kontext der rational-wissenschaftlichen Welt zu verabschieden. Nicht grundsätzlich, aber in dem hier diskutierten Bereich der Sinnsuche bzw. Spiritualität. Man macht den Schritt vom Wissen zum Glauben, überlässt sich einer individuellen Mischung von kirchlicher Offenbarung bzw. Lehre und persönlicher (oft diffuser) Gottesvorstellung.
Es war bis vor Kurzem (zumindest in einem Teil unserer Gesellschaft) ein gut geebneter Weg; man musste nicht viel tun, weil viele mitgegangen sind und überall Wegweiser standen. Aber nirgends stand ein Warnhinweis: „Achtung! Sie verlassen den Weg der Rationalität und begeben sich auf unsicheres Gelände!“
Aber wäre so eine Warntafel denn wirklich sinnvoll? Bezahlt man einen Preis, wenn man die Sinn- und Trostangebote der Religionen für sich nutzt? Ist es nicht einfach nur ein großes Geschenk, dass man sich als schwacher und oft ausgeliefert fühlender Mensch einem großen Sinnzusammenhang anvertrauen kann? Wie damals als Kind seinen allmächtig und allwissend erscheinenden Eltern?
Viele gläubige Menschen spüren einen solchen Preis offensichtlich nicht. Sie leiden nicht unter dem Widerspruch zwischen einem rationalen, an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierten Berufs- und Alltagsleben und der emotionalen bzw. spirituellen Hinwendung zu einem offensichtlich irrationalen (auf unbeweisbaren Annahmen und Dogmen aufgebauten) Glaubenssystem bzw. zu einer privaten – meist eher diffusen – Gottesvorstellung.
Gründe für diese friedliche Koexistenz lassen sich ohne Weiteres finden: ein selbstverständliches Hineinwachsen in eine gläubige Umgebung, positive Erlebnisse von Gemeinschaft und Zugehörigkeit im kirchlichen Kontext, emotionale Erfahrungen von Trost und Entlastung im stillen Gebet, das Erleben und Ausbilden einer engen Verbindung von ethischen und moralischen Werten mit religiöser Einstellung. Auf diese (oder ähnliche) Weise kann schon früh im Leben eine Grundhaltung entstehen, in der Gottesglaube und/oder religiöse Praktiken eine widerstandsfähige Festigkeit und Unirritierbarkeit bekommen.

Daneben ist für diese Menschen – oft ganz selbstverständlich – Raum für rationales Denken, wissenschaftliches Arbeiten und Orientierung an empirischen Daten. So kommt es dann dazu, dass sogar eine beträchtliche Anzahl von hochrangigen Naturwissenschaftlern sich als gläubige Menschen verstehen und outen.
Also alles kein Problem?! Nun, ganz so einfach ist die Sache nicht.
Hat Irrationalität einen Preis?
Für viele andere religiös sozialisierte Menschen ergeben sich massive Konflikte, wenn ihr naiver Kinderglaube ab dem Jugendalter mit der Welt der Vernunft, Logik und Wissenschaft konfrontiert wird. Oft sind es nagende Zweifel und belastende Schuldgefühle, die das Ringen um den richtigen Weg begleiten. Während eine Gruppe mit solchen Ambivalenzen durch ihr weiteres Leben geht, fällen andere eine (relativ) klare Entscheidung: Sie lassen die Welt des Glaubens hinter sich oder reduzieren sie auf einen kaum wahrnehmbaren Residualzustand (mit einem Kirchenbesuch zu Weihnachten und einem kirchlich begleiteten Begräbnis).
Wenn sich ja offensichtlich jede/r so entscheiden kann, wie er oder sie will, dann wäre doch alles in bester Ordnung – oder?
Natürlich besteht auf individueller Ebene das uneingeschränkte Recht, sich jedem erdenklichen religiösen System zu verschreiben. Für viele Menschen ist das ganz sicher auch die passende Möglichkeit, den eigenen spirituellen Sehnsüchten und Bedürfnissen nachzugehen und diese mit anderen – eher weltlichen Zielen – zu verbinden (z.B. dem Gemeinschaftsgefühl).
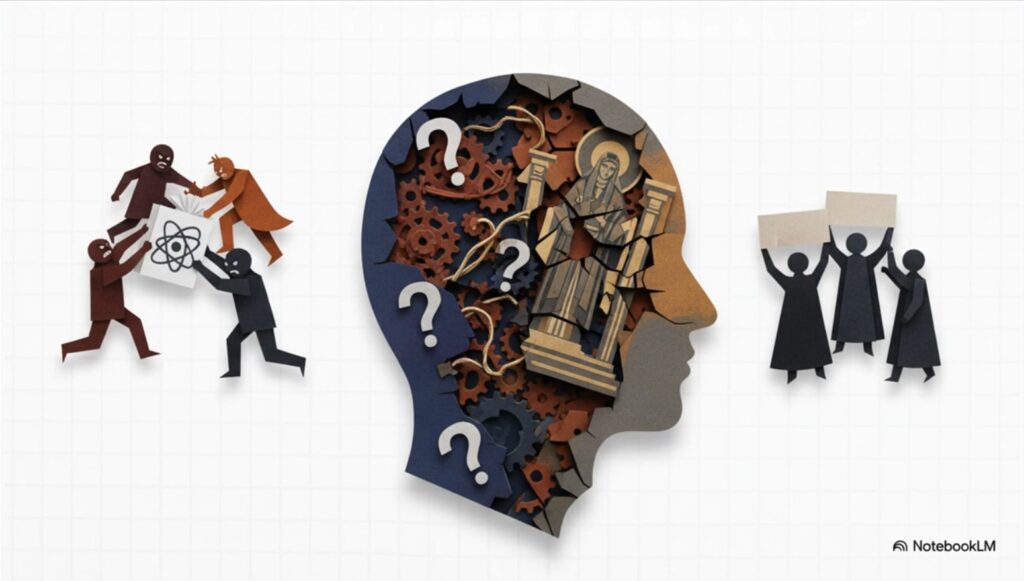
Allerdings kann man aus gesellschaftlicher Perspektive durchaus die Frage stellen, ob in Staaten mit starker bis fundamentalistischer religiöser Orientierung großer Bevölkerungsanteile nicht ein besorgniserregendes Hindernis hinsichtlich der dringend notwendigen rationalen Herangehensweise an die Menschheitsprobleme gibt. Man muss nicht bis in die orthodoxen islamischen Gottesstaaten gehen, um festzustellen, dass sich immer wieder – z.B. in den USA – eine toxische Mischung zwischen fanatischer Religiosität, Wissenschaftsfeindlichkeit, Klimawandel-Leugnung und rechter bis rechtsradikaler politischer Gesinnung zusammenbraut. Es ist offensichtlich nicht gleichgültig, ob die Bereitschaft und Fähigkeit zu rationalen und faktenbasierten Weltsichten durch eine kritiklose Hingabe an ein prinzipiell irrationales Glaubenssystem geschwächt oder gar in Frage gestellt wird.
Dabei geht es nicht nur um formale Aspekte, die bestimmten („wie wichtig sind mir empirische Erkenntnisse?“), sondern um inhaltliche Dogmen (zu Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbrüchen, Sterbehilfe, …), die eine an objektiven Kriterien („besteht Empfindungs- und Leidensfähigkeit“ bzw. „wie kann unnötiges Leid verringert werden?“) orientierte Lösungen erschweren.
Resümee
All das spricht nicht gegen eine privat gelebte Religiosität. All das stellt nicht in Frage, dass aus einem tief empfundenen Gottesglauben heraus unzählig viele moralisch hochwertige und menschenfreundliche Taten vollbracht wurden und werden. Für viele Menschen wäre es ohne Zweifel ein großes Unglück, wenn sie ihre Verortung in der Religion verlieren würden oder gar aufgeben müssten.

Die Frage ist eher: Ist die Orientierung an Glaubenssystemen tatsächlich ein attraktives Modell für die Zukunft? Bergen diese wirklich die Kraft in sich, Menschen über Kulturen hinweg auf gemeinsames Handeln zu vereinen? Gibt es genügend Anzeichen dafür, dass die beschriebenen gefährlichen Nebenwirkungen auf Dauer vermieden werden können – insbesondere die Neigung zu Irrationalismus und Absolutismus?
Wenn ich mir etwas wünschen würde, dann wäre das ein moralisches Wertesystem und ein spiritueller Weltzugang, der nicht auf der Akzeptanz einer prinzipiell irrationalen Voraussetzung basieren würde. Dann könnten auch die Menschen mit an Bord sein, für die der Preis der Missachtung ihrer Vernunft zu hoch ist.
Gelegentlich wird von klugen Menschen darauf hingewiesen, dass ja nicht alle Menschen zu allen Zeiten ihres Lebens das emotionale Urvertrauen, die sozialen Bindungen und das kognitive Rüstzeug und/oder das Bildungsniveau mitbringen, die ihnen die Orientierung an den eher logischen und rationalen Aspekten der Welt ermöglicht. Muss man nicht beispielsweise auch die eher „basalen“ und vielleicht sogar „naiven“ Bedürfnisse von Kindern, einfacher strukturierten oder sehr betagten Menschen berücksichtigen, die sich nach emotionalem Halt und nach unmittelbarem Trost und Geborgenheit in der zugewandten und gütigen Obhut eins höheren „Gegenübers“ sehnen?
Das ist ein wichtiger Gedanke. Natürlich werden durch Religionen auch magische und mystische Anteile des Menschen und archaische Bedürfnisse nach einer verlässlichen und schützenden Autorität angesprochen. Können wirklich alle Menschen dazu befähigt werden, die „objektive“ Zufälligkeit und Sinnlosigkeit des Lebens auf diesem Planeten mit gesundem Geist und stabiler Psyche auszuhalten? Ist die emotionale Verfasstheit des Menschen wirklich darauf angelegt, gegenüber einer klar empfundenen existentiellen Einsamkeit zu bestehen?
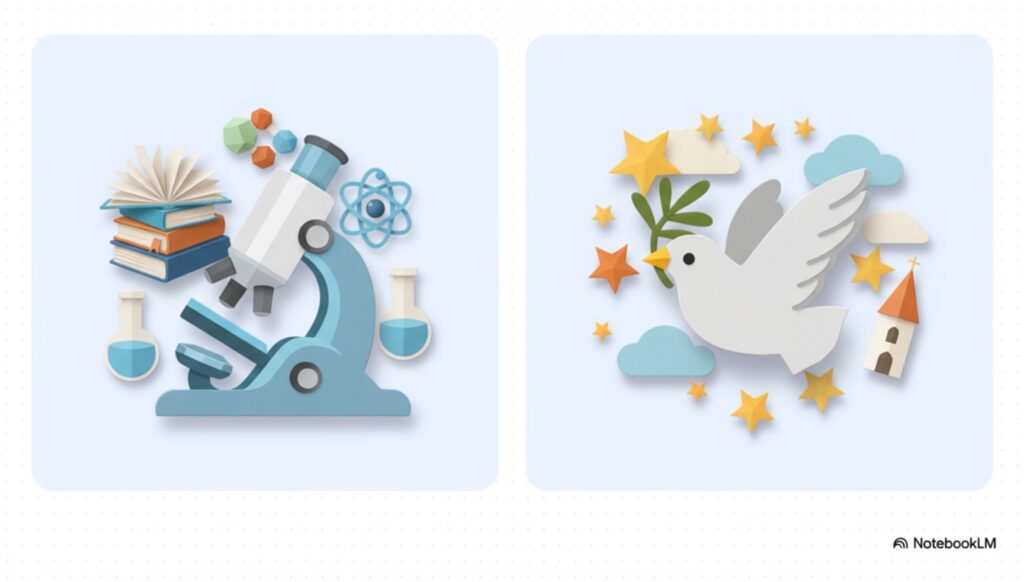
Deutlich zu weit geht m.E. Hartmut ROSA, ein namhafter Teilnehmer am aktuellen sozialwissenschaftlichen bzw. philosophischen Diskurs: Er schreibt der Religion eine quasi unersetzbare Rolle sowohl für bestimmte Resonanzerfahrungen als auch für die demokratische Kultur allgemein zu.
Ohne Zweifel können wir nicht jedes spirituelle Bedürfnis, jeden Wunsch nach Transzendenz mit dem nüchternen Hinweis auf die „seelenlosen“ Naturgesetze und den logischen Gang der Evolution beantworten. Der Mensch, sein Gehirn und seine Psyche suchen nach mehr – und genau deshalb ist das Kapitel über Spiritualität an dieser Stelle noch nicht zu Ende.
Denn eines ist wohl eindeutig: Das Verschwinden der Religionen in einer aufgeklärten und säkularen Welt wäre nur dann ein echter Fortschritt, wenn den Menschen alternative Wege zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach Sinn, Zugehörigkeit, Trost und Spiritualität zur Verfügung stehen würden. Und ähnlich wie bei den Glaubensgemeinschaften üblich, müsste es sich dabei nicht nur um unverbindliche Angebote handeln
Vielleicht finden wir ja Antworten, die andere Formen von Sinnstiftung ermöglichen – zumindest für die Menschen, die sich in dem Spannungsfeld zwischen Rationalität und Irrationalität nicht besonders wohl fühlen.
Möglicherweise ist ja ein bewusst gelebter säkularer Humanismus eine Alternative – insbesondere, wenn er auch Emotionalität und Gemeinschaftsgefühl anspricht. Im Kap. „Atheismus“ wird dieser Gedanke weiterverfolgt.
Zum Weiterdenken
Was sind Ihre ersten Gedanken oder inneren Bilder, wenn sie sich eine Welt ohne Religion vorstellen? Empfinden Sie eher Sorgen oder Erleichterung?
Würden Sie sich eine Modernisierung der großen Religionssysteme wünschen, die sich mit dem aktuellen Zeitgeist (Familienbilder, Sexualmoral, Gleichberechtigung) arrangieren? Oder würde dann etwas Entscheidendes verlorengehen?

Vorläufer-Themen
Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?
Parallel-Themen
Ist Atheismus mehr als die Verneinung von Gott und Religion? Kann es einen erfüllenden WELTZUGANG auf der Grundlage einer atheistischen Weltsicht geben?
In welchen Bereichen sucht (und findet) der Mensch tiefe Erfahrungen, inneren Frieden oder Zugehörigkeit, die über die alltäglichen und materiellen Aspekte des Lebens hinausgehen?
In welchen besonderen Lehren und Praktiken suchen Menschen Erfahrungen bzw. Erkenntnisse, die außerhalb der rational-empirischen Weltzugänge liegen? Wie sind die Folgen einzuschätzen?
Welche persönlichen Zugänge zur Welt nutzen die Menschen, um über Spiritualität hinaus eine persönliche Erfüllung in ihrem Leben zu finden? In welchen Tätigkeiten finden Sie Sinn?
Nachfolge-Themen
Wie sind die unterschiedlichen WELTZUGÄNGE hinsichtlich der anstehenden Gestaltungsfragen zu beurteilen?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante Videos
Zwei KIs streiten über Gott
Ein Streitgespräch über Religion vs. Atheismus, ausgetragen von zwei aktuellen (2025) KI-Systemen.
Auch die jeweiligen Argumente werden von KIs bewertet.
Ein interessantes Experiment!
Streitgespräch mit HÜBL u.a. beim SRF
Ein lebhaftes öffentliches Streitgespräch über Religion vs. Atheismus, ausgetragen zwischen einem atheistischen Philosophen, einer Astrophysikerin und einem Theologen. Ganz spannend…
Journalist und Autor Tobias HABERL
Ein linksliberaler Journalist „verteidigt“ sein persönliches christliches Bekenntnis und begründet, warum ihn das „Irrationale“ des Glaubens nicht abschreckt.
Richard DAWKINS
(gute deutsche Untertitel)
Eine ältere Rede, in der einer der bekanntesten Atheisten der Welt über die Unvereinbarkeit von Religion und Wissenschaft spricht.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- WELTZUGÄNGE: Verschiedene Formen, wie Menschen die Welt emotional, spirituell erschließen und verstehen.
- Glaubenssysteme: Organisierte oder persönliche Überzeugungen und Dogmen, die Sinn und Orientierung bieten.
- Sinnstiftung: Das menschliche Bedürfnis, dem eigenen Dasein und der Welt Bedeutung zu verleihen.
- Spiritualität: Die Suche nach tieferen Erfahrungen, innerem Frieden oder Zugehörigkeit jenseits des Materiellen.
- Transzendenz: Das Streben nach oder die Erfahrung von etwas, das über die alltägliche oder materielle Welt hinausgeht.
- Rational-wissenschaftlich: Ein Weltzugang, der auf Vernunft, Logik, empirischen Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
- Irrational: Basierend auf unbeweisbaren Annahmen oder Dogmen, nicht im Einklang mit Vernunft oder Logik.
- Dogmen: Festgelegte Lehrsätze oder Überzeugungen, die nicht hinterfragt werden dürfen.
- Säkular: Weltlich, nichtreligiös; sich auf weltliche Angelegenheiten beziehend.
- Humanismus: Eine Weltanschauung, die den Menschen und seine Vernunft in den Mittelpunkt stellt.
- Absolutismus: Die Neigung, eigene Überzeugungen als absolut und unzweifelhaft richtig anzusehen.
- Resonanzerfahrungen: Erfahrungen, bei denen Menschen sich mit der Welt oder anderen verbunden und berührt fühlen (im Kontext von Hartmut Rosa).
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Was ist laut dem Text das primäre Ziel der Betrachtung von Religionen in diesem Abschnitt?
- Welche Besonderheit organisierter Religiosität wird hervorgehoben, die sie von anderen spirituellen Angeboten unterscheidet?
- Warum führt die Entscheidung gegen Religion in modernen Gesellschaften zu einem „kleinen Verwaltungsakt“, während sie in anderen Kulturen schwerwiegende Folgen haben kann?
- Welche Entscheidung ist laut dem Text mit der Hinwendung zum religiösen Weltzugang verbunden?
- Warum empfinden laut dem Text viele gläubige Menschen keinen Widerspruch zwischen rationalem Leben und religiösem Glauben?
- Welche Konflikte können für religiös sozialisierte Menschen im Jugendalter entstehen?
- Was ist laut dem Text aus gesellschaftlicher Perspektive fragwürdig, insbesondere in Staaten mit starker religiöser Orientierung?
- Welche inhaltlichen Dogmen religiöser Systeme werden als Erschwernis für objektive Lösungen von Menschheitsproblemen genannt?
- Warum stellt der Text die Orientierung an Glaubenssystemen als Modell für die Zukunft in Frage?
- Welche Alternative zu religiösen Glaubenssystemen wird im Text als möglicher Weg zur Befriedigung spiritueller Bedürfnisse genannt?
Kommentare zu dieser Seite
Ihre Meinung interessiert mich sehr! Angezeigt werden allerdings nur sachliche und respektvolle Kommentare.
Vielleicht möchten Sie alternativ im Weltverstehen-Forum diskutieren?
Gerne können Sie dort mit Ihrem Beitrag auch ein neues Thema eröffnen.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben.








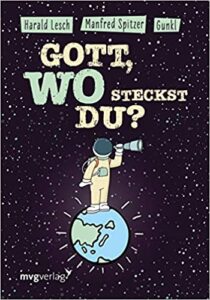
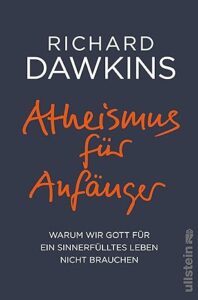
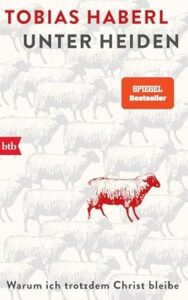

Schreibe einen Kommentar