Der Rote Faden
Frieden oder Krieg? Das ist wohl eine der Kernfragen des menschlichen Daseins, die sich durch alle Phasen der Menschheitsgeschichte gezogen hat.
Antworten darauf, ob und auf welchem Weg der Mensch zur Friedfertigkeit fähig ist, findet man zunächst bei den übergeordneten Menschenbildern: Wie sehr ist der Mensch evolutionär, biologisch, psychisch, sozial oder kulturell auf Krieg oder Frieden hin geprägt? Die einzelnen Humanwissenschaften geben für ihren Bereich darauf eine Menge – nicht ganz widerspruchsfreie – Antworten. Diese wurden im Teil WELTERKLÄREN berührt.
Auch die unterschiedlichen WELTZUGÄNGE stehen mit dem Friedensthema in Beziehung; am deutlichsten wird das im Kapitel über Moral.
Doch wir sind hier bei der WELTGESTALTUNG und stellen uns daher die Frage, wie wir unsere Gesellschaften bzw. das internationale Miteinander gestalten könnten (oder müssten), um die Geißel des Krieges enfgültig aus der Menschheitsgeschichte zu vertreiben.
Einige Ideen dazu wurden in dem Eingangs-Test schon angedeutet.
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Warum gibt es Kriege?
Vorlesen lassen
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Es gibt Krieg, weil wir biologische Wesen sind, die durch die Logik der Evolution auf das Überleben – genauer gesagt auf die Weitergabe unserer Gene – hin programmiert sind. Zu diesen biologischen Programmen gehört auch der Kampf mit Artgenossen um Nahrung, Lebensraum, Sexualpartner, Einfluss und Status. Da der Mensch nur in Gruppen überlebensfähig ist, hat er (auch) die Fähigkeit zur Kooperation, zum Altruismus und zur Empathie. Gleichzeitig ist diese soziale Grundausrichtung damit verbunden, dass er sehr klar zwischen seiner Bezugsgruppe (Ingroup) und den Fremden (Outgroup) unterscheidet. Auch diese Tendenz ist sehr tief in seinen biologischen Mustern eingebrannt.

In der Menschheitsgeschichte haben sich seit der – wohl eher friedlichen und egalitären – Phase des Jägers und Sammlers zwei grundsätzlich gegenläufige Entwicklungen ergeben:
– Kriegerischer ist der Mensch u.a. dadurch geworden, dass er nach der Sesshaftwerdung Land und Besitz zu verteidigen hatte, dass machtvolle Erzählungen (Narrative) zur Grundlage von ideologisch motivierten Konflikten wurden (z.B. Religionskriege), dass im Rahmen der Migrationsströme immer größere Teile der Welt erst besiedelt und dann kolonialisiert wurden, dass durch große und komplexe Machtsysteme auch wirkmächtige und effiziente militärische Strukturen entstanden, dass mit der naturwissenschaftlichen Revolution auch das Kriegshandwerk industrialisiert und technisiert wurde.
– Auf der Seite der Friedfertigkeit standen kulturelle und zivilisatorischen Fortschritte, in denen das Vermeiden von Leid, moralische Aspekte von Humanität und Nächstenliebe, die Anerkennung von grundlegenden Menschenrechten und die Idee von Vernunft, internationalem Interessensausgleich und Abrüstung an Bedeutung gewannen.
Wo lag die Hoffnung?
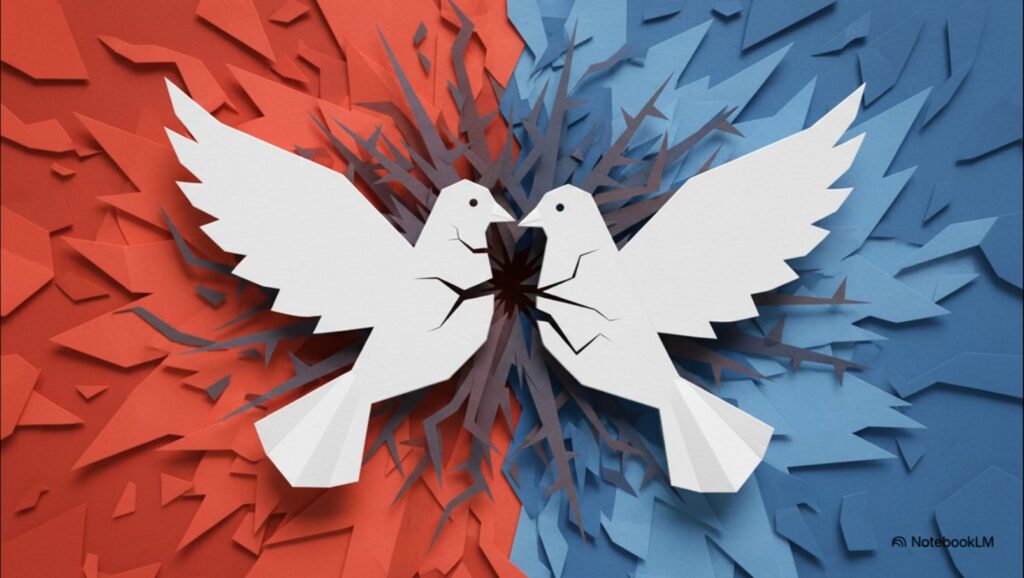
In Bezug auf die uralte Dynamik von Ingroup und Outgroup ließ sich – trotz aller Rückschläge – eine historische Tendenz erkennen, dass im Rahmen einer wirtschaftlichen Verflechtung und einer wachsenden humanistischen Friedens-Idee die Grenzen um die eigene Bezugsgruppe immer weiter gesteckt wurde: War das friedlich-kooperative Zusammenleben anfangs nur im erweiterten Familien-Clan denkbar, wurde das Gefühl der Zugehörigkeit später auf ganze Regionen, Nationen oder ganze Völkerbündnisse auszuweiten versucht. Die Erklärung der Menschenrechte und die Gründung der UNO waren nach dem 2. Weltkrieg die Höhepunkte dieser hoffungsvollen Entwicklung, die 2015 durch die Verabschiedung internationaler Nachhaltigkeits-Ziele (Sustainable Development Goals; SDG) eine Ergänzung fand.
Wo stehen wir heute?
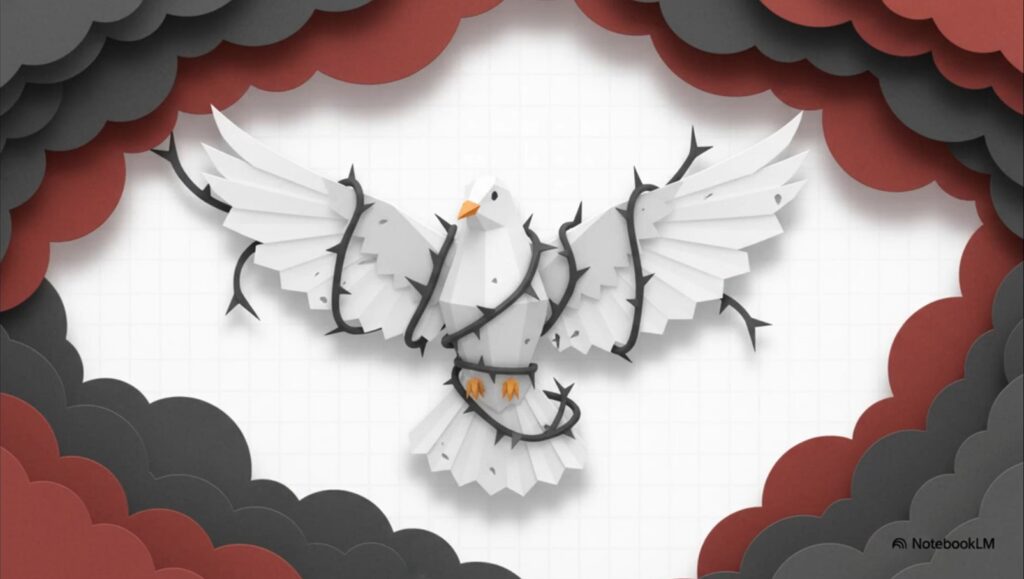
Jetzt (im Jahre 2025) ist von dem vorsichtigen Optimismus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts kaum noch etwas zu spüren: Nachdem zunächst der Zusammenbruch des Ostblocks fast euphorische Hoffnungen ausgelöst hatte, sind im neuen Jahrhundert Egoismus, Imperialismus und Militarismus in die Weltpolitik zurückgekehrt (aus der sie natürlich nie ganz verschwunden waren). Dieser Planet macht sich gerade auf den Weg einer beispiellosen Aufrüstung – sowohl mit den fast schon archaisch wirkenden Kampfmaschinen des 20. Jahrhunderts, als auch mit den modernsten KI-gesteuerten und zunehmend autonomen Waffensystemen. Besonders tragisch ist dabei, dass sich selbst friedliebende Gesellschaften diesem Sog kaum entziehen können.
Aktuell haben sich in dieser angespannten Situation die traditionellen Lager der verteidigungspolitischen „Tauben“ und „Falken“ aufgelöst bzw. neu zusammengesetzt: Frühere Vertreter der Friedensbewegung plädieren jetzt besonders vehement für Waffenlieferungen in die Ukraine und eine starke Bundeswehr, während eine andere Fraktion sich möglichst rasch mit dem Aggressor Putin arrangieren und den Aufrüstungsplänen entgegentreten wollen.
So ist das – potentiell verbindende – Friedensthema aktuell ideologisch überlagert und insgesamt von Unsicherheiten und Ängsten bestimmt.
Was bleibt zu tun?

Der Gedanke, dass es letztlich doch eines klar definierten Außenfeindes bedürfte, um die Menschheit von internen Kriegen abzuhalten, drängt sich mal wieder in den Vordergrund: So wäre dann endlich die gesamte Menschheit eine Ingroup. Unverständlich bleibt es in diesem Zusammenhang, dass die drohenden Klima- und Umweltkatastrophen noch immer nicht als ein solcher potentiell tödliche Gegner erkannt wird.
Wenn die kriegerischen Tendenzen vorrangig innerhalb unserer Gesellschaft ihr Unwesen treiben würden, könnten wir auf Überlegungen aus den Kapiteln Pluralismus, Freiheit und Bildung & Erziehung Bezug nehmen: Wir könnten dann unser Wissen anwenden, unter welchen Rahmenbedingungen friedensförderliche Wertesysteme etabliert und gepflegt werden könnten.
Vielleicht könnten wir etwas stolzer darauf sein, dass es doch in unser Gesellschaften eine ziemlich stabile Abwehr gegen einen aggressiven Nationalismus und Kriegstreiberei gibt. Nicht alle pädagogischen und politischen Einflussnahmen auf das Wertesystem bleib also ohne Folgen.
Auf internationaler Ebene können wir bisher nur träumen von einem durchsetzungsstarken Weltbündnis, das keinen Raum mehr ließe für individuelle oder gesellschaftliche Fehlentwicklungen wie Nationalismus, Machtstreben, materieller Gier, Narzissmus, Dummheit oder Größenwahn. Es müsste jedem Außenbetrachter unseres Weltgeschehens absurd vorkommen, dass eine Spezies, die Gehirne operieren und Atome spalten kann, sich von einzelnen asozialen Persönlichkeiten und ihren Oligarchen in Kriege treiben lässt.
Der Gedanke, ob die Beschränkungen der menschlichen Vernunft und Emotionalität möglicherweise so prinzipiell sind, dass nur ein Eingriff in seinen Bauplan oder eine Verantwortungsübergabe an eine KI einen Ausweg schaffen könnte, wird auch an anderer Stelle diskutiert.

Realistischer könnten z.B. folgende pragmatische und mühsame Einzelschritte sein:
– das beharrliche Schmieden von Bündnissen zwischen den Nationalen, die zumindest keine eigenen imperialistischen Ambitionen haben
– konsequentes Ausüben von moralischem, politischen und wirtschaftlichen Druck auf alle Staaten, die sich aggressiv und konfliktverschärfend verhalten
– die Reformierung und Stärkung der UNO und des Sicherheitsrates (Abschaffung der Veto-Option)
– eine Konzentration der militärischen Forschung und Investitionen auf reine Verteidigungssysteme
– Erforschung und Ausbau von nicht-militärischen Möglichkeiten der Abwehr und Resilienz („Wie kann man auch ohne klassische militärische Kriegsführung verhindern, dass ein Aggressor seine Ziel erreichen kann?“)
– internationale Zusammenarbeit in der Friedens- und Konfliktforschung (unter Beteiligung der modernen Humanwissenschaften und KI-Systemen)
– Intensivierung der historischen und sozialwissenschaftlichen Forschung zu den Faktoren, die friedliche Konfliktlösungen erleichtern bzw. zu Eskalationen führen.
Die Erkenntnis ist eindeutig: Der Krieg ist für den Menschen kein biologisch fest programmierter Naturzustand: Die längste Zeit seiner evolutionären Entwicklung gab es eher wenig organsierte Gruppengewalt. Aber der Mensch kann durch politische, wirtschaftliche, psychologische und kulturelle Einflüsse zu einem Wesen geprägt werden, für den Krieg unausweichlich oder gar natürlich erscheint – wieder alle Vernunft und Moral.
Wir müssen uns all dieser Erkenntnisse bedienen, wenn wir als Spezies noch eine Weile überleben wollen!
Zum Weiterdenken
Für welche Position hatten Sie sich (im Test) vorrangig entschieden – zwischen Gesinnungs-Pazifismus und Abschreckung durch Aufrüstung?
Wie hätten Sie sich früher entschieden – vor 3, 10 oder 20 Jahren?
Die meisten müssten wohl einen Moment darüber nachdenken, was sich warum verändert hat…
Wie „naiv“ erscheinen Ihnen die Vorschläge am Ende des Textes? Lohnt es sich, darüber nachzudenken und daran zu arbeiten?

Vorläufer-Themen
Was macht den Wesenskern des Menschen aus? Was macht ihn zum Menschen? Welche Stellung hat er im Universum?
Wie kommt Moral in unsere Welt? Gibt es eine objektive und allgemeingültige Moral? Auf welche Prinzipien könnte man sich über alle Kulturen hinweg einigen?
Nachfolge-Themen
Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
terraX über Frieden
Eine informative Doku über die Geschichte von Krieg und Frieden. Reich bebildert und mit vielen kurzen Interviews.
Rutger BREGMAN beim SRF
In einem TED-Talk von 2024 gibt der legendäre Digital-Prophet einen beeindruckende Einblick in Geschichte und Zukunft der KI und in einige Aspekte des Transhumanismus.
(Einbettung des Videos nicht möglich; der Link führt zu YouTube)
Podiums-Diskussion zu „Die Evolution der Gewalt“
Eine ausführliche Darstellung und Diskussion zum Buch im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- Ingroup: Die eigene Bezugsgruppe, zu der sich eine Person zugehörig fühlt und mit der sie kooperiert.
- Outgroup: Gruppen von Fremden, die nicht zur eigenen Bezugsgruppe gehören und gegenüber denen oft Misstrauen oder Aggression bestehen kann.
- Narrative: Machtvolle Erzählungen oder Geschichten, die oft als Grundlage für ideologisch motivierte Konflikte dienen können.
- Welterklärung: Der Prozess oder Bereich des Verstehens und Erklärens der Welt und ihrer Phänomene.
- Weltgestaltung: Der Prozess oder Bereich des bewussten Beeinflussens und Gestaltens der Welt, oft im gesellschaftlichen, politischen oder ethischen Kontext.
- Gesinnungs-Pazifismus: Eine Haltung, die Krieg und Gewalt aus prinzipiellen, moralischen Gründen ablehnt.
- Abschreckung durch Aufrüstung: Die Strategie, Kriege durch eine starke militärische Überlegenheit zu verhindern.
- UNO: Vereinte Nationen, eine internationale Organisation zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit und des Friedens.
- Sustainable Development Goals (SDG): Internationale Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden.
- Resilienz (nicht-militärisch): Die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich gegen aggressive Handlungen zu wehren oder ihnen zu widerstehen, ohne klassische militärische Mittel einzusetzen.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Wie erklärt der Text die biologische Veranlagung des Menschen zu Krieg und Konflikt?
- Neben der biologischen Prägung, welche historischen Entwicklungen haben laut Text den Menschen kriegerischer gemacht? Nennen Sie zwei Beispiele.
- Welche zivilisatorischen Fortschritte werden im Text als förderlich für die Friedfertigkeit des Menschen genannt?
- Wie beschreibt der Text die historische Entwicklung des Ingroup/Outgroup-Konzepts in Bezug auf die Idee des friedlichen Zusammenlebens?
- Welche Ereignisse nach dem 2. Weltkrieg werden als Höhepunkte einer hoffnungsvollen Entwicklung hin zu mehr Frieden genannt?
- Wie beschreibt der Text die aktuelle (Stand 2025) weltpolitische Lage in Bezug auf Frieden und Aufrüstung?
- Wie hat sich laut Text die traditionelle Aufteilung zwischen verteidigungspolitischen „Tauben“ und „Falken“ in der aktuellen Situation verändert?
- Welcher Gedanke drängt sich laut Text immer wieder in den Vordergrund, um die Menschheit von internen Kriegen abzuhalten?
- Welche Art von Weltbündnis wird im Text als Ideal beschrieben, das individuelle oder gesellschaftliche Fehlentwicklungen eindämmen könnte?
- Nennen Sie zwei der im Text vorgeschlagenen pragmatischen Schritte zur Förderung des Friedens auf internationaler Ebene.
Kommentare zu dieser Seite
(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).




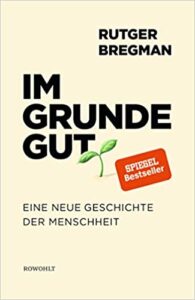
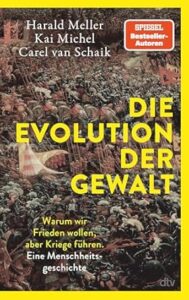
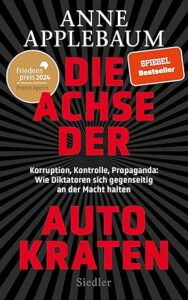
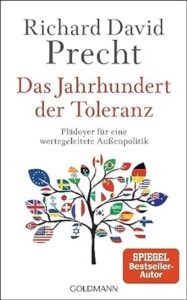
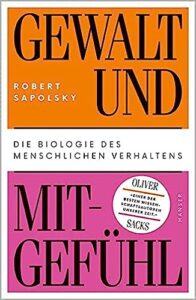
Schreibe einen Kommentar