Der Rote Faden
Es dürfte schnell aufgefallen sein, dass der in diesem Projekt gewählte Ausschnitt von WELTERKLÄREN und WELTGESTALTEN sich schwerpunktmäßig auf Themenbereiche der Natur- und Humanwissenschaften konzentriert.
Zwar betreffen Fragen zur Gerechtigkeit und zum Umgang mit Ungleichheit und Reichtum auch wirtschaftliche Aspekte; es ging aber bisher nicht um die bedeutsame Frage, auf welchem Wege überhaupt Wirtschaftsleistungen entstehen.
Diese Lücke soll jetzt hier bei den Zukunfts-Szenarien ein wenig geschlossen werden.
Jedem wird einleuchten, dass zwischen den verschiedenen Entwicklungs-Bereichen eine enge Verbindung besteht. So wird die Lage der Weltwirtschaft, der nationalen Arbeitsmärkte und des individuellen Lebensstandards in hohem Umfang von den technologischen, geopolitischen und klimatischen Rahmenbedingungen abhängig sein.
Diese komplexe Gemengelage schreit geradezu nach KI-Unterstützung…
Tipp: Besonders interessant ist die Rückmeldung über Ihre eigene Haltung zu diesem Thema, wenn Sie den Test vor dem Lesen durchführen.
Vorlesen lassen
Um sich einem Thema zu nähern, bei dem die Entwicklung der KI-Technologie eine zentrale Rolle spielen wird, liegt es nahe, sich dieser Ressource auch bei der Bearbeitung zu bedienen.
Statt – wie bisher – selbst zu kategorisieren und zu formulieren, habe ich das Angebot von „PERPLEXITY – Deep Research“ (Stand Feb. 2025) genutzt und gebe die Antwort hier unverändert (allerdings ohne die zahlreichen Quellenangaben) wieder.
(Die Aussagen im Eingangs-Test – die sich grob an den hier folgenden 5 Szenarien orientieren – stammen allerdings von mir):
Sie haben die Möglichkeit, sich in dieses Thema auch durch eine kurze Video-Präsentation oder in Form eines ausführlichen dialogischen Gesprächs einführen zu lassen:
Fünf Szenarien für Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Zeitalter von KI, Automatisierung und Klimawandel
Die kommenden 25 Jahre werden die globalen Wirtschaftsstrukturen und Arbeitsmärkte durch das Zusammenspiel von technologischem Fortschritt, Klimawandel und geopolitischen Verschiebungen grundlegend transformieren. Dieser Bericht skizziert fünf mögliche Entwicklungspfade, die von einer vollständigen Integration künstlicher Intelligenz (KI) bis hin zu dystopischen Klimakrisenszenarien reichen. Basierend auf aktuellen Prognosen des Sachverständigenrats für Wirtschaft, Zukunftsstudien zur Arbeitswelt und Klimafolgenanalysen werden folgende Kernaussagen deutlich: Die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels könnten bis 2050 globale Einkommensverluste von 19 % verursachen, während gleichzeitig KI-basierte Automatisierung sowohl Produktivitätsgewinne als auch strukturelle Arbeitsmarktverschiebungen bewirken wird. Die Energieversorgung wird zum entscheidenden Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, und Arbeitszeitmodelle müssen sich an veränderte Produktionsbedingungen anpassen.
Szenario 1: Die Smarte Maschinen-Gesellschaft
KI als Treiber ökonomischer Effizienz
In diesem optimistischen Szenario dominieren KI-Systeme und Robotik die Wertschöpfungsketten, wodurch die Produktivität um durchschnittlich 3,5 % pro Jahr steigt. Algorithmen übernehmen nicht nur repetitive Aufgaben, sondern auch komplexe Planungs- und Steuerungsprozesse in Industrie, Logistik und Dienstleistungen. Der Sachverständigenrat für Wirtschaft verweist auf das Potenzial digitaler Zahlungssysteme wie des digitalen Euros, um Transaktionskosten zu senken und Finanzierungsengpässe für Innovationen zu überwinden.

Arbeitsmarkt im Umbruch
Arbeitszeitmodelle reduzieren sich auf eine 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, da KI 40 % der heutigen Tätigkeiten automatisiert. Neue Berufsfelder entstehen im Bereich KI-Überwachung, Ethik-Management und Mensch-Maschine-Kollaboration. Die Einkommensverteilung folgt einem hybriden Modell: Grundsicherungssysteme kompensieren untere Lohnsegmente, während Hochqualifizierte über leistungsbezogene Boni an Produktivitätssteigerungen partizipieren.
Klimawandel und Energieversorgung
Durch KI-optimierte Smart Grids erreicht der Anteil erneuerbarer Energien 85 % bis 2045. Carbon-Capture-Technologien und präzise Klimamodelle begrenzen die globale Erwärmung auf 1,8 °C, wodurch die prognostizierten Einkommensverluste auf 7 % reduziert werden. Deutschland etabliert sich als Exporteur von grünen Wasserstofftechnologien, was Handelsbilanzüberschüsse trotz rückläufiger Industrieproduktion sichert.
Szenario 2: Fragmentierte Plattform-Ökonomie
Entstehung digitaler Mikromärkte
Digitale Plattformen dominieren 70 % der Wirtschaftsaktivitäten, wobei Gig-Work und projektbasierte Beschäftigung zur Norm werden. KI-gesteuerte Matching-Systeme verteilen Aufgaben in Echtzeit an global verfügbare Arbeitskräfte, was zu einem Wettbewerbsdruck führt, der Reallöhne in niedrigqualifizierten Sektoren um 15–20 % senkt. Der Sachverständigenrat warnt vor institutionellen Lücken bei der Regulierung plattformbasierter Geschäftsmodelle, die steuerliche Mindereinnahmen und Sozialversicherungsdefizite verursachen.

Energieversorgung als geopolitischer Konfliktherd
Dezentrale Energieerzeugung durch Prosumer-Netzwerke konkurriert mit staatlichen Monopolstrukturen. In Entwicklungsregionen führt der unzureichende Ausbau erneuerbarer Energien zu Versorgungsengpässen, die Migrationsströme auslösen und globale Lieferketten destabilisieren. Die Klimafolgenkosten erreichen hier 28 % des regionalen BIP, was Schuldenkrisen und Handelsprotektionismus verschärft.
Arbeitszeiten zwischen Flexibilität und Ausbeutung
Während Wissensarbeiter*innen ihre Arbeitszeit autonom gestalten, unterliegen physische Dienstleistungskräfte algorithmischen Kontrollsystemen, die Pausenzeiten minimieren. Kollektivverträge verlieren an Bedeutung, da individuelle Leistungsdaten über Reputationssysteme entlohnt werden. Die OECD verzeichnet eine Spaltung der Gesellschaft in „Digital Nomads“ mit hohem Wohlstand und prekäre „Klickarbeiter“ ohne soziale Absicherung.
Szenario 3: Resiliente Kreislaufwirtschaft
Postwachstumsorientierte Wohlstandsmodelle
Angetrieben durch Klimaschutzauflagen und Ressourcenknappheit etabliert sich eine Kreislaufwirtschaft, die das BIP-Wachstum durch Indikatoren wie Lebensqualität und ökologischen Fußabdruck ersetzt. Die Industrieproduktion sinkt um 30 %, während Reparatur-, Recycling- und Upcycling-Dienstleistungen 45 % der Wertschöpfung ausmachen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit fördert globale Partnerschaften zur gerechten Ressourcenverteilung gemäß der Agenda 2030.

Arbeitsmarkt im Dienst der Nachhaltigkeit
Staatlich geförderte „Green Jobs“ in Renaturierung, Energiesanierung und ökologischer Landwirtschaft schaffen 12 Millionen neue Arbeitsplätze in der EU. Arbeitszeitkonten ermöglichen flexible Modelle zwischen 15 und 35 Wochenstunden, gekoppelt an individuelle CO2-Bilanzen. KI-Systeme dienen primär der Optimierung von Materialströmen, während menschliche Arbeit auf kreative und empathische Tätigkeiten fokussiert bleibt.
Klimaanpassung als Wirtschaftsfaktor
Investitionen in klimaresiliente Infrastruktur erreichen 5 % des globalen BIP, was die Einkommensverluste durch Klimawandel auf 11 % begrenzt. Deutschland nutzt seine Ingenieurskompetenz zum Export von Hochwasserschutzsystemen und trockenresistenten Agrartechnologien. Energiecommunities betreiben lokale Microgrids, die durch KI-gesteuerte Lastenverteilung Netzstabilität garantieren.
Szenario 4: Neo-Merkantilistische Blockbildung
Geopolitische Spaltung der Wertschöpfungsketten
Handelskonflikte und Technologieembargos führen zur Bildung autarker Wirtschaftsblöcke (EU, USMCA, China-ASEAN), die durch KI-gestützte Zollsysteme und lokale Produktionsquoten geschützt werden. Der Sachverständigenrat prognostiziert dadurch einen dauerhaften BIP-Verlust von 0,8 % pro Jahr für exportabhängige Volkswirtschaften wie Deutschland.
Arbeitsmärkte unter Sicherheitsvorbehalt
Staaten subventionieren strategische Schlüsselindustrien (Halbleiter, Pharmazie, KI-Entwicklung) mit Garantiearbeitsplätzen, die eine 40-Stunden-Woche bei hoher Überwachungsdichte vorsehen. Qualifikationsanpassungen erfolgen durch verpflichtende KI-Trainingsprogramme, deren Algorithmen individuelle Lernpfade steuern. Die ILO warnt vor der Erosion gewerkschaftlicher Rechte unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit.
Fossile Renaissance mit Klimakollateralschäden

Trotz Klimaziele setzen Wirtschaftsblöcke auf heimische Kohle- und Gasvorkommen, um Energieunabhängigkeit zu erreichen. Die CO2-Konzentration überschreitet 550 ppm, was bis 2050 zu Einkommenseinbußen von 23 % führt. Geoengineering-Projekte wie stratosphärische Aerosolinjektionen werden ohne internationale Abstimmung implementiert, was regionale Klimaungerechtigkeiten verschärft.
Szenario 5: Turbokapitalistische Hyperglobalisierung
Entfesselte Märkte und exponentielle KI-Expansion
Deregulierte Finanzmärkte und privatisierte KI-Entwicklung beschleunigen das Wirtschaftswachstum auf Kosten sozialer und ökologischer Standards. Autonomous-Corporation-Entities (ACEs) – vollständig automatisierte Firmen – generieren 60 % der globalen Gewinne, während menschliche Arbeit auf Nischenbereiche beschränkt bleibt. Der digitale Euro entwickelt sich zum globalen Reservecurrency, begünstigt durch blockchainbasierte Clearingmechanismen.

Arbeitszeit als Luxusgut
Eine transnationale Elite arbeitet 15 Stunden pro Woche in kreativ-strategischen Positionen, während die Mehrheit der Bevölkerung in „Human Maintenance“-Jobs (Pflege, Bildung, Unterhaltung) mit 45-Stunden-Wochen um Existenzsicherung kämpft. Universelles Grundeinkommen wird durch Mikrotransaktionen im Metaverse ergänzt, die algorithmisch an Verhaltensdaten geknüpft sind.
Klima-Kollaps und techno-utopische Gegenmaßnahmen
Trotz Überschreitung der 2 °C-Schwelle setzen ACEs auf riskante Climate-Engineering-Lösungen: Ozeandüngung zur CO2-Bindung, Gentechnik-Superbäume und orbitale Solarfarmen. Die dadurch ausgelösten ökologischen Kipppunkte reduzieren die landwirtschaftliche Produktivität um 35 %, was Migrationskrisen und Handelskriege auslöst.
Synthese und Handlungsempfehlungen
Die analysierten Szenarien verdeutlichen, dass die Wechselwirkung zwischen technologischem Fortschritt und Klimaresilienz die zentrale Stellschraube zukünftiger Wohlstandsentwicklung ist. Politisch bedarf es:
- KI-Governance-Rahmen, die Automatisierungsgewinne durch Maschinensteuern umverteilen und Weiterbildungsprogramme algorithmengesteuert priorisieren.
- Klimabedingte Handelspräferenzen, die Länder mit ambitionierten Reduktionszielen durch Zollvergünstigungen belohnen.
- Energiepartnerschaften, die Europas Wasserstoffbedarf durch Investitionen in afrikanische Solarinfrastruktur decken und gleichzeitig lokale Wertschöpfung fördern.
- Arbeitszeitflexibilisierung via KI-gestützter Arbeitsvolumenprognosen, die Erwerbsarbeit mit Klimaanpassungsdienstleistungen (z.B. Aufforstung) verknüpfen.
Nur durch eine vorausschauende Gestaltung der digital-ökologischen Doppeltransformation lassen sich dystopische Entwicklungen abwenden. Die Kosten des Nichthandelns übersteigen die Investitionen in nachhaltige Technologien um den Faktor – ein ökonomisches wie ethisches Imperativ.
(Eigenes) Resümee
Soweit der KI-Assistent, der sich für diese kleine Recherche (Anfang 2025) insgesamt auf 39 Internet-Quellen bezogen hat.
Für unsere Zwecke ließe sich festhalten:
– Globale wirtschaftliche Szenarien bieten (vielleicht ähnlich wie Wetterprognosen) ein gutes Beispiel dafür, wie mithilfe von KI komplexe Prozesse strukturiert betrachtet werden können.
– Die (in diesem Fall wirtschaftswissenschaftliche) Analyse von Daten und Trends kann die Grundlage dafür schaffen, die Zukunft aktiv zu gestalten.
– Auch Handlungsempfehlungen lassen sich durchaus auf rational-wissenschaftlicher Ebene ableiten.
– Auch wenn es letztlich psychologische, soziale, ethische und politische Faktoren sind, die darüber entscheiden, welche Ziele und welche Wege eingeschlagen werden: Eine solide Daten- und Faktengrundlage kann für solche Entscheidungen eine gute Basis schaffen.
(Die Frage, ob die Entscheidungen selbst auch gleich von einer KI gefällt werden sollte, wird an anderer Stelle diskutiert).
Inhaltlich – das wird kaum überraschen – wird hier dem 3. Szenario mit der größten Sympathie begegnet: Die Wirtschaft der Zukunft kann ohne eine Nachhaltigkeits-Priorität nicht wirklich zukunftsfähig sein. Dass sie damit auch die „humanste“ Form sein würde, steht wohl außer Zweifel.
Eine Abschluss-Anmerkung zu aktuellen politischen Diskussionen:
Angesichts der hier skizzierten globalen wirtschaftlichen Entwicklungsoptionen erscheinen so vermeintlich tiefgreifende gesellschaftliche Konfliktthemen wie die Zukunft unserer Sozialversicherungssysteme provinziell, banal und fantasielos. Im Jahre 2025 darüber zu streiten, unter welchen Rahmenbedingungen z.B. die umlagefinanzierte Rente auch in 20 oder 30 Jahren noch funktionieren könnte, zeugt von einer geistigen Fixierung auf eine (Arbeits-)Welt, die es ganz sicher dann längst nicht mehr geben wird.
Gesellschaftlicher Reichtum wird in Zukunft immer weniger von traditionellen menschlichen Berufsbiografien abhängen – dafür umso mehr von vollautomatisierter Produktion, digitalen Dienstleistungen, dem Handel mit Rohstoffen, Daten und Medien und von der Finanzwirtschaft. Es wird keine Alternative dazu geben, alle notwendigen gesellschaftlichen Leistungen aus dem dort erwirtschafteten Wohlstand zu bestreiten – weitgehend unabhängig davon, welche konkreten Arbeitsleistungen einzelne Personen unter diesen Bedingungen erbringen können, wollen oder müssen.
Man muss nur einfach damit beginnen, Strukturen und Systeme vorzubereiten, mit denen der insgesamt generierte Reichtum auch dort landet, wo er für die Erfüllung der gesellschaftlichen Aufgaben benötigt wird. Diese Herausforderung wird man nicht dadurch umgehen können, dass man so tut, als ob es um ein paar Jahre mehr Lebensarbeitszeit oder eine Begrenzung der Rentenhöhe gehen würde.
Es geht um völlig neue Modelle – für die endlich wenigstens mal ein Denkraum geschaffen werden muss!
Zum Weiterdenken
Welche Fantasien haben Sie über ein „normales“ Arbeitsleben in 25 Jahren? Wären Sie davon noch betroffen?
Welche Gefühle lösen die Prognosen aus, die auf eine Arbeitswelt hindeuten, in denen Roboter und KI die menschliche Arbeit weitgehend ersetzen werden?

Vorläufer-Themen
Zu welchen Schlussfolgerungen hinsichtlich der modernen wissenschaftlichen Erklärung der Welt kann man kommen?
Wie lassen sich die in dieser Abhandlung abgeleiteten Prinzipien der WELTGESTALTUNG zusammenfassend beschreiben?
Parallel-Themen
Welche Rolle wird die Künstliche Intelligenz zukünftig spielen? Gibt es mehr Grund zur Sorge oder zur Hoffnung?
Was sind die globalen Trends, die sich für die nächsten 10 – 20 Jahre abzeichnen?
Nachfolge-Themen
Kann man die Kernbotschaft dieses Web-Projektes wirklich in ein paar kurzen Abschnitten zusammenfassen?
Auch das soll versucht werden.
Relevante Buchbesprechungen
Ein Klick auf das Cover führt zu meiner ausführlichen Rezension
Relevante YouTube-Videos
Harald LESCH über Kreislaufwirtschaft
LESCH trägt seine Vorstellungen von einem Wirtschaftssystem der Zukunft vor, das im Einklang mit den ökologischen Notwendigkeiten steht. Klar und logisch.
Michael SANDEL beim SRF
Ein erhellendes Gespräch über die Schattenseiten der der Leistungsgesellschaft. SANDEL ist ein wichtiger liberaler Intellektueller in den USA.
GLOSSAR
Eine kurze Erklärung der wichtigsten Begriffe
- Geopolitische Verschiebungen: Veränderungen in den globalen Machtverhältnissen und Beziehungen zwischen Staaten, die sich auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirken.
- Sachverständigenrat für Wirtschaft: Ein Gremium von Wirtschaftsexperten, das die Regierung berät (im deutschen Kontext oft „Wirtschaftsweise“ genannt).
- Wertschöpfungsketten: Die Abfolge von Aktivitäten, die ein Unternehmen durchführt, um ein Produkt oder eine Dienstleistung von der Konzeption bis zur Auslieferung an den Endverbraucher zu erstellen.
- Digitaler Euro: Eine hypothetische digitale Form der Euro-Währung, die von der Europäischen Zentralbank ausgegeben und kontrolliert würde.
- Smart Grids: Intelligente Stromnetze, die digitale Technologien nutzen, um die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung zu optimieren.
- Carbon-Capture-Technologien: Technologien, die Kohlendioxid (CO2) aus industriellen oder anderen Quellen abscheiden, um dessen Freisetzung in die Atmosphäre zu verhindern.
- Gig-Work: Eine Form der kurzfristigen oder projektbasierten Beschäftigung, oft über digitale Plattformen vermittelt.
- Prosumer-Netzwerke: Netzwerke, in denen Einzelpersonen oder Haushalte sowohl Energie produzieren (z. B. durch Solaranlagen) als auch konsumieren.
- Kreislaufwirtschaft: Ein Wirtschaftsmodell, das darauf abzielt, Abfall zu minimieren und Ressourcen so lange wie möglich im Kreislauf zu halten, oft durch Reparatur, Wiederverwendung und Recycling.
- Postwachstum: Eine Wirtschaftsideologie, die darauf abzielt, den Wohlstand nicht durch kontinuierliches BIP-Wachstum, sondern durch andere Indikatoren wie Lebensqualität und ökologischen Fussabdruck zu definieren.
- Green Jobs: Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt zur Verbesserung der Umweltqualität beitragen.
- Neo-Merkantilismus: Eine Wirtschaftspolitik, die darauf abzielt, die heimische Industrie durch Zölle, Subventionen und andere Massnahmen zu schützen und gleichzeitig die Exporte zu fördern.
- Autarke Wirtschaftsblöcke: Wirtschaftliche Regionen oder Ländergruppen, die darauf abzielen, in hohem Masse von Importen unabhängig zu sein und die heimische Produktion zu stärken.
- Autonomous-Corporation-Entities (ACEs): Vollständig automatisierte Unternehmen, die ohne menschliche Intervention agieren (im Szenario 5).
- Metaverse: Ein virtueller, persistenter digitaler Raum, in dem Nutzer interagieren können, oft über Avatare.
- Climate-Engineering: Grossräumige Eingriffe in das Klimasystem der Erde, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.
- KI-Governance-Rahmen: Regelwerke und Strukturen zur Steuerung der Entwicklung und des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz.
- Klimabedingte Handelspräferenzen: Handelspolitische Massnahmen, die Länder oder Produkte mit besseren Klimabilanzen bevorzugen.
- Energiepartnerschaften: Kooperationen zwischen Ländern zur Sicherung der Energieversorgung, oft unter Fokus auf erneuerbare Energien.
- Arbeitszeitflexibilisierung: Modelle, die eine variable Gestaltung der Arbeitszeit ermöglichen.
Alles erfasst?
Vielleicht haben Sie Lust zu überprüfen, ob Ihnen die wichtigsten Gedankengänge des Textes noch präsent sind. Zur Kontrolle können Sie die Ihre Antworten auf die folgenden Fragen überprüfen.
- Welcher Schwerpunkt wurde in den vorherigen Teilen des WELTERKLÄREN und WELTGESTALTEN Projekts gesetzt, bevor wirtschaftliche Themen behandelt wurden?
- Welche drei Hauptfaktoren werden laut dem Text die globalen Wirtschaftsstrukturen und Arbeitsmärkte in den kommenden 25 Jahren transformieren?
- Wie wurde die KI-Technologie bei der Erstellung des Abschnitts „Fünf Szenarien für Wirtschaft und Arbeitsmarkt“ genutzt?
- Was ist ein Kernergebnis des Szenarios „Die Smarte Maschinen-Gesellschaft“ in Bezug auf die Arbeitszeit?
- Was kennzeichnet die Einkommensverteilung im Szenario der „Fragmentierten Plattform-Ökonomie“ laut der OECD?
- Welche Art von Arbeitsplätzen entstehen laut Szenario 3, „Resiliente Kreislaufwirtschaft“, in grossem Umfang in der EU?
- Was sind laut Szenario 4, „Neo-Merkantilistische Blockbildung“, zwei Folgen für den Arbeitsmarkt unter dem Aspekt der nationalen Sicherheit?
- Was sind „Autonomous-Corporation-Entities (ACEs)“ im Szenario 5, „Turbokapitalistische Hyperglobalisierung“?
- Welche zentrale Stellschraube für zukünftige Wohlstandsentwicklung wird in der Synthese der Szenarien hervorgehoben?
- Warum erscheinen laut dem Resümee des Textes aktuelle politische Diskussionen über Sozialversicherungssysteme angesichts der skizzierten globalen Wirtschaftsszenarien als banal?
Kommentare zu dieser Seite
(Nur sachliche und respektvolle Kommentare werden angezeigt. Noch lieber wäre mir ein Betrag zu meinem Forum.
Falls Sie Namen oder Mailadressen nennen: Ich werde diese niemals selbst nutzen oder für irgendwelche Zwecke an Dritte weitergeben).





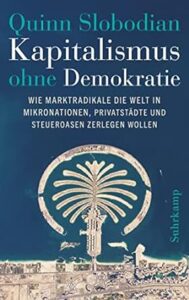
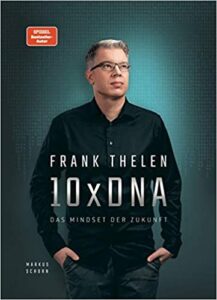
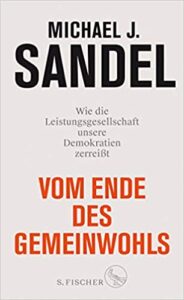
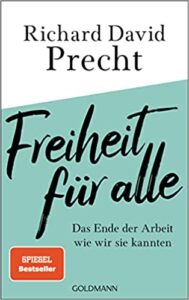
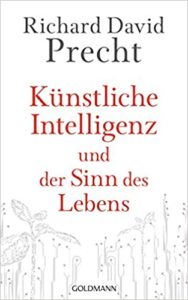
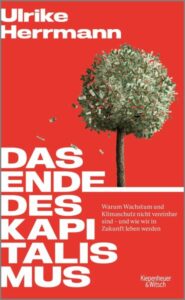
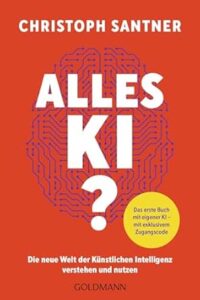
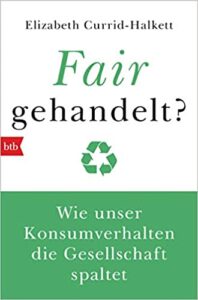
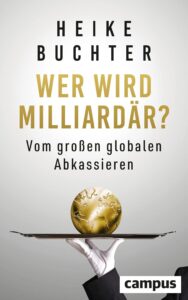
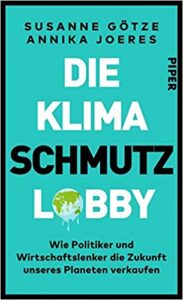
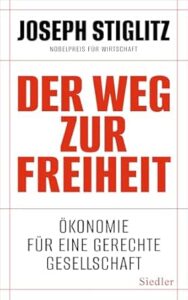
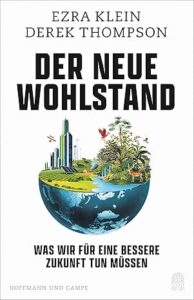

Schreibe einen Kommentar